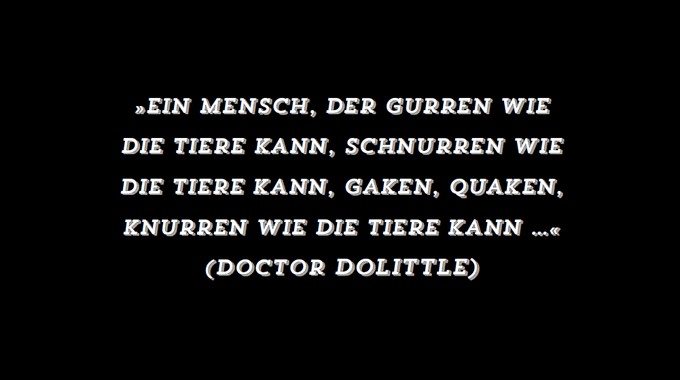
 »Rettet die Tiere!«
»Rettet die Tiere!«
Susann Witt-Stahl
Der Veterinär John Dolittle aus Puddleby-on-the-Marsh verfügt über ein außergewöhnliches Bildungskapital. Er beherrscht 498 Tiersprachen: von Schweinisch bis zu diversen Fischdialekten. Er ist kein Genie, aber was ihn von den meisten anderen Menschen unterscheidet: Er versteht die Tiere, weil er sie liebt, ihnen zuhört – weil er sie verstehen will.
Im Hause Dolittle, das Schafe, Kühe, Enten und andere tierische Schützlinge beherbergt, ist alles radikal anders als in der Welt draußen. Tiere werden als Vorbilder geschätzt (»sie können Freunde sein – warum können wir es nicht?«). »Guten Tag, Miss Polynesia«, begrüßen die Besucher Dolittles kluge Beraterin, eine Papageiendame, artig, beinahe ehrfürchtig. Allen Lebewesen wird stets mit Respekt begegnet. »Fleisch – es würde die Tiere verletzten, wenn ich hm … Also lass ich es lieber. Ich finde, dass man es überhaupt grundsätzlich vermeiden sollte, seine guten Freunde zu essen«, klärt Dolittle den kleinen Tommy Stubbins auf. Der Junge wird zum treuesten Verbündeten des Doktors. Etwa wenn es darum geht, das »kleine Seemädchen« Sophie aus einem Wanderzirkus zu befreien, damit es zurück zu seiner Familie an den Nordpol schwimmen kann. »Ich sehe die Weisheit der Welt in deinen Augen«, singt er ihm in der Musicalverfilmung der Kinderbuchreihe von Hugh Lofting aus dem Jahr 1967 zum Abschied (dass die Nebendarsteller dressierte Tiersklaven sind, ist eine bittere Ironie).
So ein fantastischer Film war wohl nur zu einer Zeit möglich, als Herbert Marcuse, die intellektuelle Ikone der Studentenaufstände, schon laut darüber nachdachte, was nach der – seiner Ansicht nach unmittelbar bevorstehenden – Revolution geschehen sollte: »Die Tiere befreien natürlich.«
Aber Dolittle lebt noch nicht im Reich der Freiheit. Er landet im Gefängnis für seine guten Taten. Vor Gericht wird er zwar freigesprochen, soll aber wegen »Bedrohung der öffentlichen Sicherheit« den Rest seines Lebens in einer »Anstalt für Geistesgestörte« verbringen.
Auf Speziesgrenzen sprengende Solidarität steht die Höchststrafe im »Wolkenkratzer«, wie Max Horkheimer die kapitalistische Gesellschaft genannt hat. Die in seinem dunklen Kellerverlies, einem Schlachthof, Zusammengepferchten haben nur ein Recht: elendig zu verrecken. »Unterhalb der Räume, in denen millionenweise die Kulis der Erde krepieren«, so Horkheimer, »wäre dann das unbeschreibliche, unausdenkliche Leiden der Tiere, die Tierhölle.« John Dolittle hat die Kellertür aufgestoßen und eine dem verwalteten Menschen lästige Wahrheit über »den Schweiß, das Blut, die Verzweiflung der Tiere« ans Tageslicht gebracht und die einzig wahrhaft menschliche Konsequenz gezogen: Er beschützt die Allerwehrlosesten, so gut er kann.
Genau das macht Dolittle hochgradig verdächtig und zum Außenseiter: In einer Welt, in der »die Menschen einander und der Natur so radikal entfremdet sind, dass sie nur noch wissen, wozu sie sich brauchen und was sie sich antun«, schrieben Adorno und Horkheimer in ihrer Zivilisationskritik »Dialektik der Aufklärung«, »gilt, aufs Tier zu achten, nicht mehr bloß als sentimental, sondern als Verrat am Fortschritt«.
Aber in der Utopie (griech. »Nicht-Ort«, »Nirgendheim«), in der Dolittles Geschichte weitergeht, nimmt das Schicksal des Doktors einen anderen, schöneren Lauf: Er kann mit Hilfe seiner Freunde fliehen und begibt sich auf eine Abenteuerreise, auf der sein großer Lebenstraum in Erfüllung geht: die Begegnung mit der rosa Riesenschnecke. Am Ende fliegt ihn eine Mondmotte in den Sternenhimmel Richtung Heimat. Dort ist er mittlerweile rehabilitiert. Speziesübergreifende Solidarität – ein Generalstreik der Tiere hat ganz Großbritannien lahmgelegt – kann eben auch Unmögliches möglich machen.
Ist John Dolittle ein Held? Nein. Er verweigert sich nur einer instrumentellen Vernunft, die immer neue und perfidere Methoden für den Massenmord auf Schlachtfeldern und in Schlachthöfen ersinnt, und handelt lieber wahrhaft vernünftig: Er übt Mitgefühl. Er ist der Agent einer Gesellschaft, die es zu erkämpfen gilt – einer Menschheit, die, will sie überleben, ihre Entfremdung gegenüber der inneren und äußeren Natur abstreifen und sich selbst als natürliches Kollektivsubjekt erkennen muss. Wenn Dolittle Zeilen wie »Rettet die Tiere! / Eines Tages werden sie vielleicht uns retten« singt, dann artikuliert sich nichts anderes als die Natur, die ihre Augen aufgeschlagen hat, sich aus ihrem gewaltdurchwirkten Zustand befreien will und – wie es der italienische Philosoph Marco Maurizi ausdrückt – »versucht, ein neues Wort auszusprechen: Friede«.
Den Artikel lesen Sie in der M&R 2/2015, erhältlich ab dem 27. Februar 2015 am Kiosk, im Bahnhofsbuchhandel oder im Abonnement. Die Ausgabe können Sie auch im M&R-Shop bestellen.
Ähnliche Artikel:
Anzeigen


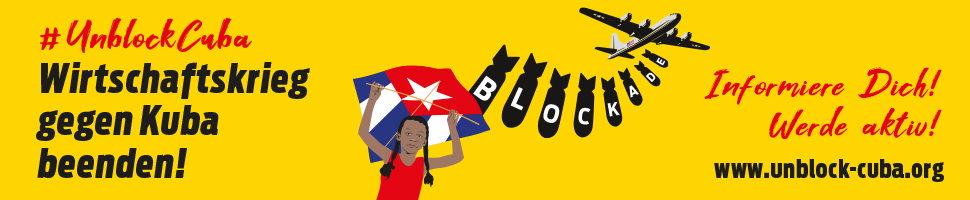

 Fotos von Katja Koschmieder und Jens Schulze
Fotos von Katja Koschmieder und Jens Schulze








