
Foto: Kathryn Kendall
Über Kollektivität in der Musik und die Unmöglichkeit einer linken Kulturindustrie
Interview: John Lütten
Die US-amerikanische Band Consolidated war von 1988 bis 1994 aktiv. Sie mischte Industrial-Beats mit politischem Rap und verstand sich explizit als linksradikale Gruppe. Ihre Agenda: »This Is a Collective«. M&R sprach mit Ex-Frontmann Adam Sherburne über Musik als Form sozialer Organisation, den Antikollektivismus der Kulturindustrie und die Widersprüche linker Popkultur.
Consolidateds erste Veröffentlichung erschien 1989, als der Siegeszug des Neoliberalismus endgültig besiegeltwar: Die Sowjetunion brach zusammen. In Großbritannien hatte Thatcher die Arbeiterklasse plattgemacht, und die USA gingen gerade von der Reagan-Ära in die Präsidentschaft George Bushs über. Warum gründeten Sie Ihr Projekt zu diesem Zeitpunkt – war das Zufall, oder wollten Sie dem Zeitgeist etwas entgegensetzen?
Mehrere Dinge waren ausschlaggebend. Einerseits der Niedergang der Sowjetunion, auf den die neue Weltordnung von Bush, Thatcher und Co. folgte, die Brutalität des Kapitalismus, die wir global, aber auch im eigenen Alltag erfahren mussten, insbesondere durch Ausbeutung, die wir als Musiker in früheren Projekten erlebt hatten. Auf der anderen Seite entstanden neue Bewegungen wie die Umwelt-, die Tierbefreiungs- oder die Queer-Bewegung, die sich mit der Antikriegs-, Bürgerrechts- und Arbeiterbewegung zusammentaten. Wir wollten auf die politische Situation reagieren und diese Bewegungen stärken. Außerdem waren die 1990er-Jahre die goldenen Jahre des Hip-Hop, über den viele schwarze Musiker und andere Gruppen ihren Protest gegen soziale Ungerechtigkeit ausdrückten. Die sozialen und künstlerischen Möglichkeiten waren also grenzenlos – zumindest dachten wir das damals.
Ihr Song »This Is a Collective« liest sich wie ein Manifest: »Consolidated is a collective, always accessible never isolated / Don’t be intimidated by the pressure and hate / We never said you had to assimilate / We’re just a group, but you can make an impact«, heißt es darin. Warum war Ihnen das Kollektiv so wichtig?
Weil der Neoliberalismus sich anschickte, jede Form progressiver Gemeinschaft aufzulösen und durch pseudoindividualistischen Kommerz zu ersetzen, insbesondere in der Musikindustrie. Dem wollten wir etwas entgegensetzen und versuchen, die Regeln einer solchen Industrie nicht zu befolgen. Nehmen Sie die frühen Hip-Hop- oder Big-Band-Gruppen, die aus den schwarzen Communities kamen. Deren Musik wurde immer im Kollektiv gespielt, und sie behandelte alltägliche Erfahrungen, das Leben in den Stadtteilen etc. Die Bands betrieben Musik also als eine Form sozialer Organisation. Sie spiegelte den sozialen Zusammenhalt, hielt aber immer das Gleichgewicht zwischen der Gruppe und den einzelnen Musikern. Sobald diese Gruppen der – überwiegend von Weißen dominierten – Musikindustrie ausgesetzt wurden, schrumpften sie; die Kollektive verschwanden, und ihre Musik veränderte sich.
Neben der politischen Kritik wollte ich auch Texte schreiben, die dem Hörer Musik nicht nur in ihrer kulturindustriell zugerichteten Form und als von »Stars« geschaffenes Konsumprodukt zeigen sollten. Und wir als Band versuchten, die Mechanismen und Widersprüche des »Band-Seins« zu überwinden. Songs wie »Consolidated« oder »This Is a Collective« richten sich daher gegen die hierarchischen und monologischen Strukturen der Musikindustrie, mit denen wir uns konfrontiert sahen.
Wie wird denn die »musikalische Kollektivität«, von der Sie sprechen, durch den Kapitalismus beeinflusst? Und hat sie ein fortschrittliches Potenzial?
Nun, sie ist vielleicht die radikalste Form von Gemeinschaftlichkeit überhaupt und wird daher von der Entwicklung der Gesellschaft beeinflusst wie alle anderen Facetten des sozialen Lebens. Historisch sehen wir zum einen, dass Musik immer etwas war, in dem Menschen ihren Alltag und ihr Leben reflektiert und verarbeitet haben; zum anderen wurde sie auch immer von den jeweiligen Produktionsverhältnissen geprägt. Deswegen wird musikalische Kollektivität heute maßgeblich vom Kapitalismus geformt: So wie die Leute in irgendwelchen Büros sitzen und einzelne Funktionen ausüben, werden die Musiker von der Industrie auf eine Funktion – Sänger, Gitarrist, Drummer usw. – reduziert. Oder sie sitzen völlig vereinzelt und entfremdet vor ihren Laptops und produzieren Musik, die dann gar nichts Kollektives mehr hat. Zugleich kann uns aber der Zusammenhalt, den wir in der Musik erfahren, auch zeigen, wie eine freie Gemeinschaft ohne Kapitalismus aussehen könnte – ohne Pseudoindividualismus, aber auch ohne erzwungene Gemeinschaft. Darin besteht ihr revolutionäres Potenzial, und darum ging es auch bei Consolidated.
Auch auf Ihren Live-Konzerten brachten Sie diese Einsicht zum Ausdruck. Regelmäßig unterbrachen Sie Ihre Auftritte, um mit dem Publikum über die Musik zu diskutieren, und Sie stellen ein offenes Mikro für Wortbeiträge bereit. Einige wurden aufgenommen und sind auf Ihren Alben zu hören.
Ja, genau. Das Publikum derart in das Konzert einzubeziehen, macht daraus eine starke kollektive Erfahrung – sowohl für die Musiker als auch für die Besucher. Die Idee dazu hatte unser Drummer, und sie entpuppte sich als einer der wichtigsten Beiträge zum Projekt. Nicht nur gab das dem Publikum eine Kraft, die die Musikindustrie ihm gar nicht geben wollte, es machte die Auftritte auch spontaner und lebendiger – es war nicht mehr einfach »unsere Show«. Jahre später gab es viele Punkbands, die dem Publikum das Mikro überließen. Aber dadurch, dass wir die Aufnahmen auch für unsere Alben verwendeten, überließen wir den Konzertbesuchern sogar die Lead Vocals in einigen unserer Songs.
Heute hingegen kokettieren viele als »progressiv« gelabelte Musiker damit, gerade keinem Kollektiv anzugehören. Sie lehnen jede Form von Gemeinschaft ab und verkaufen bourgeoisen Individualismus als radikale und fortschrittliche Haltung. Hat der Neoliberalismus auch die Subkultur ergriffen?
Total! Zumindest die, die in irgendeiner Form mit Business verbunden ist. Aber mal abgesehen von einzelnen Musikern, die bürgerliche und reaktionäre Ideologie verbreiten – der ganze Zweck kulturindustrieller Musik ist die Legitimation des Kapitalismus. Auch die »kritische« Popkultur ist Teil dessen, was ich als »social justice industry« bezeichne: ein Business, das vorgibt, fortschrittliche und kritische Botschaften zu vermitteln, letztlich aber ein Geschäft bleibt, bei dem es um Geld und Profit geht. Natürlich darf man politische und kritische Statements abgeben, wenn man Teil dieser Industrie ist. Aber letzten Endes sind die Bedingungen, unter denen man die eigene Kunst produziert, immer darauf ausgerichtet, aus der Erfahrung von Gemeinschaftlichkeit eine Ware zu machen und sie zu kommerzialisieren. Und man kann sich den Konsequenzen, die das für seine Kunst hat, nicht entziehen. Ob man will oder nicht, das ganze Verständnis etwa von »Performance« oder von »Band-Sein« wird von diesen Mechanismen beeinflusst. Und wenn man versucht, dem einen »politischen« oder »linken« Anstrich zu verpassen, endet man als nützlicher Idiot des Neoliberalismus.
Wie können sich Musiker und Kulturschaffende dagegen wehren?
Na ja, wenn sie entscheiden, Teil der Kulturindustrie zu werden, dann kommen sie nicht umhin, sich derlei Widersprüchen auszusetzen. Das betrifft Musiker wie mich ebenso wie kritische Journalisten oder Intellektuelle. Sie könnten Ihr Magazin ja auch nicht machen, ohne Werbung zu schalten, und Sie müssen sich mit diesen ganzen Bands und anderem reaktionären Quatsch herumärgern. In den letzten Jahrzehnten sind diese Widersprüche immer stärker geworden, weil die Musikindustrie in einer Krise steckt. Neue Technologien wie File-Sharing, neue Software und neue Möglichkeiten, Kunst zu veröffentlichen – neue Produktivkräfte, wenn Sie so wollen –, machen es der Industrie immer schwerer, mit Kunst Geld zu machen. Deswegen ist der Druck, den sie auf Musiker ausübt, heute so riesig.
Für mich war der konsequente Schritt das Projekt, das ich jetzt mache: »Free Music! Stop America!« Mit diesem Projekt versuchen wir genau da anzufangen, wo diese ganzen Widersprüche an ihre Grenze stoßen. Wir versuchen, Musiker jenseits von Geld und Industrie und jenseits der Widersprüche von »eine Show spielen« oder »Künstler sein« zusammenzubringen. Wir touren durch verschiedene Länder und Städte und spielen auf den Straßen Jams, die so spontan und offen wie möglich sein sollen, so dass jeder, der gerade in der Nähe ist, sich beteiligen kann – Sie glauben nicht, was für eine Power so etwas entwickeln kann! So versuchen wir, Musik wieder zu einer Kraft des Zusammenhalts zu machen und ihr den Warencharakter zu nehmen. So wie wir die Abschaffung von Kapitalismus und Ausbeutung nicht an irgendwen delegieren können, können wir auch die Musik nur selber befreien. Wir versuchen also, uns die musikalischen Produktionsmittel anzueignen und der Musik das revolutionäre Potenzial zurückzugeben.
Consolidated haben sich 1994 aufgelöst. Heißt das, Ihre damalige Agenda ist gescheitert?
Nein, nicht gescheitert. Aber als wir merkten, dass wir gegen die Widersprüche der Kulturindustrie nicht länger ankommen und an eine Grenze stoßen, entschieden wir, uns an diesem Business nicht länger zu beteiligen. Die Idee, die hinter Consolidated stand, ist die gleiche, die ich heute mit »Free Music! Stop America!« verfolge. Dass ein Projekt wie Consolidated unter heutigen Bedingungen möglich wäre, kann ich mir nicht vorstellen, und ich würde das auch nicht wollen. Wenn Musik der Klang von Leben und Zusammenhalt ist, dann ist die Musikindustrie der Klang des Kapitalismus und freie Musik der Klang von Gerechtigkeit, Freiheit und Lust. Versuchen wir also, die Musik menschlicher und die Menschen musikalischer zu machen!
Adam Sherburne war Sänger und Gitarrist von Consolidated. Er lebt heute als freischaffender Künstler in Portland und betreibt das Projekt Free Music! Stop America!: limbabwe.com/free-music-stop-america.
Das komplette Interview lesen Sie in der Melodie und Rhythmus 6/2015, erhältlich ab dem 30. Oktober 2015 am Kiosk, im Bahnhofsbuchhandel oder im Abonnement. Die Ausgabe können Sie auch im M&R-Shop bestellen.
Ähnliche Artikel:



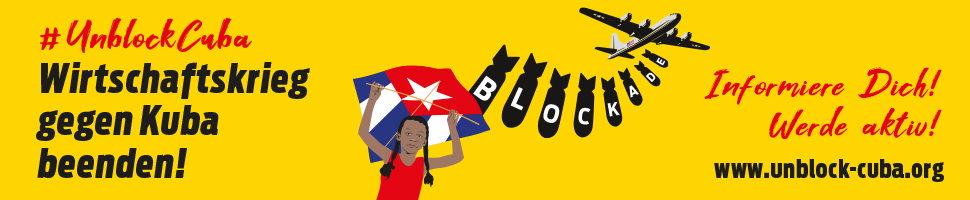

 Fotos von Katja Koschmieder und Jens Schulze
Fotos von Katja Koschmieder und Jens Schulze








