
Foto: Paul Zinken
Andreas Gabalier
»I sing a Liad für di«
Andreas Gabaliers Song »I sing a Liad für di« hätte schon vor 50 Jahren gut und gern als Musterexemplar deutschsprachigen Schlagertums firmieren können. Als Wiesn-Gaudi, Blauer- Bock-Freudigkeit oder Ballermann-Degeneration, überall wäre diese Mischung aus Humpapa-Musik und Boy-meets-Girl-Klischee, wie sie nur die bewusst-platte deutschsprachige Unterhaltungskultur zu fabrizieren vermag, in unbedarfter Dankbarkeit aufgenommen worden. Sie appelliert dezidiert ans Niedere, das sich wie auf Befehl begeisterten Publikum zumeist in kollektivem Geschunkel und rhythmischem, zuweilen ins Marschartige übergehenden Händeklatschen kundtut, im Viervierteltakt als Demonstration überbordender Lebensfreude. Dass dieses »Liad« millionenfach auf Youtube abgerufen worden ist, sich also allergrößter Popularität erfreuen darf, korrespondiert aufs Stimmigste mit seiner unhinterfragten Funktion als Produkt trivialer Kulturindustrie.
Warum aber wird es als »VolksRock’n’Roll« apostrophiert? Was soll denn an diesem Paradebeispiel eines (deutschen) Schlagers Rock’n’Roll sein? Wohl kaum seine musikalische oder textliche Substanz. Eher denkbar, dass damit das Performance-Gebaren des Sängers gemeint ist: Elvis-Schnitt als Frisur, laszive Körperhaltung, Sonnenbrillenerotik, pseudo-ekstatische Lippenbewegung, hier und da auch mal ein Griff ins Gemächt. Ein wenig irritierend: Rasierte Achselhöhlen – bei einem Rocker? Nun ja, eigentlich nur zu passend bei einem Rocker, der sowas singt und so angezogen ist wie Andreas Gabalier: Lederhosen, Bauernstiefel und karierte Armbänder als Pars pro Toto bayerischer Trachtenhemden. Gabalier ist ein Performer von »Volksmusik«, angezogen wie ein Volksmusiker, der sich als Rocker versteht, aber keiner sein kann, weil er deutschsprachige Schlager in österreichischem Volksmund singt. Und so sieht auch sein Publikum aus: euphorisierte Frauen in Dirndltracht, hingerissen und ausgelassen wie Rockkonzert-Gängerinnen, die keine sind, weil sie sich einer Folklore-Schlager-Gaudi verschrieben haben.
Aber was verstört eigentlich an diesem Phänomen? Warum wirkt die aufdringliche Freudigkeit noch verlogener als es Schlager ohnehin schon immer sind? Im 19. Jahrhundert zeichnete sich die Kunstmusik vieler Länder Europas durch die integrative Aufnahme von Volksmusik in ihre Werke aus. Nicht selten, wie im Falle Russlands, ging es dabei um ein geplantes nationales Projekt mit einem latenten ideologischen Anliegen: Da sich die Nation politisch im Nationalstaat konsolidiert hatte, in der sich nach und nach heranbildenden bürgerlichen Gesellschaft und im Zuge des Herrschaftsantritts des Kapitalismus sich zugleich aber Klassenklüfte auftaten, entdeckte man »das Volk«, dessen Kultur als organischer Bestandteil in der hegemonialen hohen Kultur aufgehoben werden konnte – gleichsam zum Zeichen vorgeblicher nationaler Einheit. Das ideologisch Verlogene daran manifestierte sich etwa in der Tatsache, dass Brahms‘, Liszts und Dvořáks »Zigeunerlieder« im bürgerlichen Salon und Konzertsaal aufgeführt werden mochten, »Zigeuner« aber nie im Publikum hätten zugegen sein können. Auch Hegel hatte ja schließlich die Revolution befürwortet, aber am liebsten ohne Revolutionäre.
Volksmusik als gelebte Kultur im Zeitalter des industriellen Kapitalismus und bürgerlicher Urbanität ist immer schon ein Anachronismus im harmlosen und eine ideologische Lüge im gängigen Fall. Was in den Folk-Rock-Bewegungen US-Amerikas sich seinerzeit noch als kulturelle Protestbewegung ausnahm, verkommt im zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts zu einer reaktionären Schnulzenromantik. Verschwistert mit entfernten Blubo*-Reminiszenzen?
* Akronym für »Blut und Boden«, ein zentrales Ideologem der NS-Herrschaft [Anm. d. Red.]
Moshe Zuckermann ist Kunsttheoretiker und lehrt an der Universität Tel Aviv (u. a. Kritische Theorie). Er hat diverse Bücher und Aufsätze über Kunstautonomie und zur Kulturindustriethese von Theodor W. Adorno veröffentlicht. Darunter »Kunst und Publikum. Das Kunstwerk im Zeitalter seiner gesellschaftlichen Hintergehbarkeit«. In den 1970er-Jahren war er als Komponist und Arrangeur tätig.
Die Analyse lesen Sie in der M&R 5/2014, erhältlich ab dem 29. August 2014 am Kiosk, im Bahnhofsbuchhandel oder im Abonnement. Die Ausgabe können Sie auch im M&R-Shop bestellen.
Ähnliche Artikel:
Anzeigen


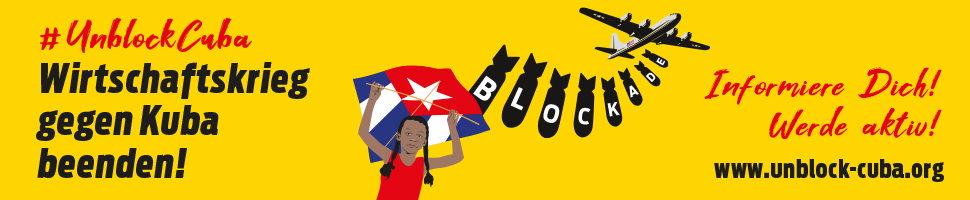

 Fotos von Katja Koschmieder und Jens Schulze
Fotos von Katja Koschmieder und Jens Schulze








