Schmerz, den man tanzen kann
Ivan Wondracek
Tango regt die Produktion von Sexualhormonen an. Mediziner vermuten, dass er Alzheimer vorbeugt. Die Musik senkt auch die Cortisolwerte: der Stress schwindet. Doch wovon sprechen wir, wenn wir »Tango« sagen? Vom Standardtanz im »Eins, zwei, Wiegeschritt«? Von einer handzahmen Variante, die Tänzer mit dem Versprechen auf ein wenig Sinnlichkeit in Tanzkurse lockt? Ein Blick auf die Ursprünge zeigt, dass Tango viel mehr sein kann: der Ausdruck eines Lebensgefühls zwischen fragiler Hoffnung und Niedergeschlagenheit.
1989 konstatierte Astor Piazzolla, es gebe keinen Tango mehr. Für ihn existierte er nur, solange »die Menschen in Buenos Aires ihn mit jedem Schritt durch die Straßen trugen und die ganze Stadt förmlich nach Tango roch«. In den 80er-Jahren, so der Komponist und Bandoneon-Spieler, hätten Rock und Punk die Rolle des Tango übernommen. Für den auf die Bedürfnisse der bürgerlichen Freizeitgesellschaft zugeschnittenen Tanz hatte Piazzolla nicht viel übrig. Der sei nur eine dümmliche Imitation. Sein Anspruch an die eigene Musik war, den Anschluss der Tradition an die Gegenwart zu schaffen, ohne die Wurzeln zu übergehen. Das Ergebnis: der Tango Nuevo.
Die Entstehung des Tango ist untrennbar mit den gesellschaftlichen Umständen im Argentinien und Uruguay der Jahrhundertwende verknüpft. Von einem Einwanderungsprogramm der argentinischen Regierung angezogen, erreichten zwischen 1880 und 1930 etwa sechs Millionen Menschen die Hafenstädte am Río de la Plata, darunter viele Spanier, Italiener und Osteuropäer. Es handelte sich aber nicht um jene Elite, die man herbeigesehnt hatte. Das Gros der Einwanderer rekrutierte sich aus verarmter Landbevölkerung und (teils ungelernten) Arbeitern. Die Mietskasernen in Buneos Aires und Montevideo waren bald überlaufen.
Den kompletten Artikel lesen Sie in der M&R 6/2014, erhältlich ab dem 31. Oktober 2014 am Kiosk, im Bahnhofsbuchhandel oder im Abonnement. Die Ausgabe können Sie auch im M&R-Shop bestellen.
Ähnliche Artikel:





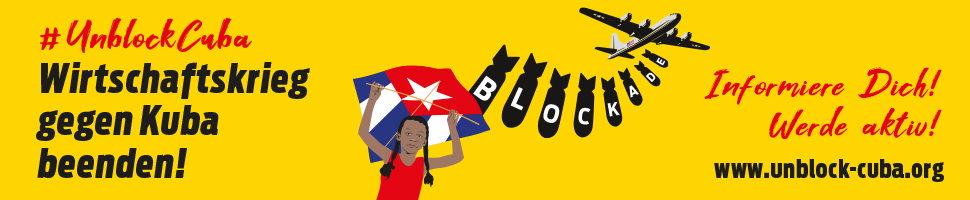

 Fotos von Katja Koschmieder und Jens Schulze
Fotos von Katja Koschmieder und Jens Schulze








