Ein ideologiekritisches Gespräch über Leiden und Schmerz in der Musik
Moshe Zuckermann & Susann Witt-Stahl
Herr Zuckermann, Sie gelten als apostrophierter Kritiker der Kulturindustrie. Der Mainstream der kommerziellen Popmusik blendet das Leiden des Menschen an existenzieller Not, an den Begleiterscheinungen der kapitalistischen Gesellschaft, an Ausbeutung und Armut, nahezu aus. Er kennt Schmerz nur in Form von Herzschmerz. Ist diese Reduktion genuin in populärer Musik angelegt oder ein Symptom von deren kulturindustrieller Verwertung?
Die Antwort liegt im Grunde schon in Ihrer Frage. Insofern es um die kommerzialisierte Populärmusik geht, also die, die von vornherein auf Konsumierbarkeit und leichte Verdaulichkeit, mithin auf mehr oder minder seichte Unterhaltung angelegt ist, handelt es sich um Kulturprodukte, die dezidiert als Waren hergestellt sind. Als solche können sich die Hersteller solcher Produkte menschliches Leid und humane Not nicht leisten, denn dies würde ja ihre Klientel, das Konsumpublikum, verscheuchen. Wer auf Unterhaltung aus ist, möchte nicht durch das Leid anderer »gestört« werden. Das wissen die Produzenten der Kulturindustrie am besten. Was sie freilich machen können, ist menschliches Leid selbst zur Ware werden lassen.
»Leid als Ware« – wie genau meinen Sie das?
Das geschieht in der Filmindustrie in Kriegs-, Katastrophen-, ja selbst in Holocaust- Filmen. Das Problem liegt zumeist in der Verwendung inadäquater Stilmittel, die zur Erzeugung von Sentimentalität, Affektüberladenheit und lupenreinem Kitsch eingesetzt werden, womit schließlich die Leiderfahrung zur Ideologie mutiert. Ein Paradebeispiel für gestandenen Pop-Mist stellt für mich Elvis Presleys »In the Ghetto« dar. In den 1960er-Jahren hat man in den Diskotheken Slow danach getanzt.
Kann es sein, dass dem kommerziellen Pop für den Ausdruck von Leiden und Schmerz schlichtweg die musikalischen Mittel fehlen? Marxistisch gesprochen: Der Entwicklungsstand der musikalischen Produktivkräfte, die ihn hervorbringen, ist von Stillstand bestimmt – er ist nie auf der Höhe der Zeit, weil immer das Gleiche serviert wird? Wirken vielleicht deshalb viele Versuche, durch kulturindustriell produzierte Popmusik Leiden zum Klingen zu bringen, meist unfreiwillig komisch? Ich denke an Gunter Gabriels »Es steht ein Haus im Kosovo« – ein Song nach der Melodie von »House of the Rising Sun«, mit dem der Vorschlag für die Abschaffung des Leids gleich mitgeliefert wird: Auslandseinsätze der Bundeswehr.
Ja, dem kommerziellen Pop fehlen die musikalischen Mittel, um Leid und Schmerz auszudrücken. Das liegt zunächst daran, dass er das musikalische Niveau senken muss, wenn er ankommen will. Das bedeutet nicht, dass dabei nicht auch schöne Sachen entstehen. Aber wenn dieser Pop sich verkaufen will, muss er im schnulzigen Sinne »anrührend« sein. Das andere Problem hängt mit dem zusammen, was Sie mit dem »Entwicklungsstand der musikalischen Produktivkräfte« apostrophieren. Die Musiksprache des Pop im 20. und 21. Jahrhundert ist nie über die des 19. Jahrhunderts hinausgekommen. Natürlich darf man nicht erwarten, dass die Pop-Sphäre sich der Stil- und Ausdrucksmittel der avancierten Kunstmusik bedient, denn das würde das Publikum unweigerlich abstoßen (ein Problem, mit dem sich übrigens die seriöse Kunstmusik heutzutage auch noch ziemlich plagen muss). Was sie einzig anstreben kann, ist ein annehmbares Niveau im Bereich des bewusst populär Produzierten.
Nun bewegt sich das Publikum nicht genuin auf niedrigem Niveau und ist in der Regel selbst Leiden ausgesetzt, die des Ausdrucks bedürfen. Wie ist es zu erklären, dass die Mehrheit dennoch beim Konsum regelrecht nach Ausblendung des Leids – sogar des eigenen – verlangt? Das ist doch zumindest vermittelt ein Akt der Selbsterniedrigung und Selbstverstümmelung?
Das Publikum per se ist an gar nichts schuld, wiewohl die Kulturindustrie nichts auszurichten vermöchte, wenn das Publikum nicht bei dem, was Kulturindustrie anrichtet, mitmachen würde. Ich habe das Gefühl, dass der Siegeszug der vulgären Populärkultur mit zweierlei zu tun hat: Zum einen ist dem Publikum im Großen und Ganzen das kulturelle bzw. symbolische Kapital abhandengekommen, dessen es bedarf, um der avancierten Kunstmusik im 20. Jahrhundert habhaft zu werden. Die Populärkultur bietet, so gesehen, eine Kompensation für die defizitäre Situation im Bereich der modernen hohen Kultur. Zum anderen wird Kunst insgesamt vom Großteil des Publikums für eine Nebensache erachtet, für ein »nice to have« und nicht für eine geistige Notwendigkeit. Mit dieser Einstellung, die ja selbst die reale Situation des Publikums in dem Sinne, wie Sie es ansprechen, widerspiegelt, ist man schnell bei der Unterhaltung als Ausflucht aus dem schweren Alltag.
Warum aber verzichten viele Menschen darauf, ihre Angst, ihre Qualen durch Musik beredt werden zu lassen? Musik ist die geeignetste Kulturform dafür. Ich denke z.B. an Bernd Alois Zimmermanns »Ekklesiastische Aktion« oder Peter Hammills »Still Life«. Ich meine, das, was Adorno in seinem Aphorismus »Aufforderung zum Tanz« über die »Vergnügungsindustrie« im NS-Staat gesagt hat: »Es gehört zum Mechanismus der Herrschaft, die Erkenntnis des Leidens, das sie produziert, zu verbieten« – das gilt in moderater Form strukturell auch für die kapitalistische Gesellschaft in Zeiten, in denen sie sich nicht zum Faschismus radikalisiert hat.
Es kommt darauf an, was Menschen lebensgeschichtlich als ihre Möglichkeiten eingeimpft wird. Mit Bourdieu gesprochen ist es der Habitus, der sehr früh prägt, was man sich als ästhetische Dimension fürs Leben aneignet. Wer nicht frühzeitig mit der Erfahrung des Konzert- und Theatersaals, mit dem Museum und dem Buchladen bekanntgemacht worden ist, wird es schwer haben, sich das späterhin noch anzueignen – wenngleich es nicht unmöglich ist. Womit das breite Publikum aber, ohne es in der Hand zu haben, aufwächst, ist die Dauerbeschallung der medial vermittelten Kommerz- und Konsumwelt. Deren Seichtigkeit gerinnt zur Matrix des ästhetischen Erlebnisses. Natürlich gibt es die Möglichkeiten, Bernd Alois Zimmermann (der dem Bereich der Kunstmusik angehört) und Peter Hammill (der zur anspruchsvollen Popkultur zu zählen ist) zu rezipieren, aber deren Werke erschließen sich nicht von selbst. Man muss lernen, sich ihnen zu öffnen. Aber die Praxis dieses Lernens ist mitnichten selbstverständlich, sie wird klassenspezifisch sehr selektiv zugänglich gemacht. Nicht nur die Erkenntnis des Leidens wird also in der kapitalistischen Gesellschaft strukturell verhindert, sondern schon die ästhetische Erziehung, die u.a. diese Erkenntnis überhaupt erst ermöglicht. Die Menschen verzichten, so besehen, auf nichts; ihnen ist noch gar nicht bewusst geworden, dass sie diese Möglichkeiten haben.
In der Popmusik, die nicht bloß zu Profitzwecken produziert wird, sind Not, Elend und Verzweiflung durchaus ein Thema. Im Folk, Blues, Tango und Black Metal bilden Leiden und Schmerz quasi die Matrix. Von US-amerikanischen Traditionals, wie »Am I Born to Die« über John Cales Interpretation von »Heartbreak Hotel« bis hin zu Werken wie »Vio Smear« von der Sound-and-Noise-Künstlerin Meira Asher, die sich auch Pop-Materials bedient. Nicht nur die »hohe Kunst« kann ein Feuerwerk des Schmerzes und unendlich herzzerreißend sein, ganz ohne Kitsch und falsche Gefühle.
Aber selbstverständlich vermag hochwertige populäre Musik, dies zu leisten. Wenn man zudem damit nicht nur die moderne, geplant verfertigte meint, sondern auch Folklore bzw. das Volkslied, dann hat man es teilweise mit der authentischsten Kulturleistung zu tun, die alles, was Menschen umgetrieben hat, zum Ausdruck brachte, ihre Freuden und Leiderfahrungen, ihre Nöte und Hoffnungen, ihre Beziehungen unter einander, ihr Verhältnis zur Natur, ihren Glauben usw. Gibt es eine herzzerreißendere »Dokumentation« des entsetzlichen Leidens afroamerikanischer Sklaven als den schwarzen Blues? Hat man je Suggestiveres von fronbäuerlichen Nöten gehört als im russischen Volksgesang? Das Problem lag noch nie in dem, was authentisch »von unten« kam, sondern immer nur in der Verfertigung von kommerziellen Produkten »von oben«, die sich als das authentische »Unten« gerieren. Auf diese Feststellung hat bereits Adorno großen Wert gelegt, als er über das Phänomen der spätkapitalistischen Kulturindustrie nachsann. Und entsprechend kann man sagen, dass auch die gegenwärtige Populärmusik Hochwertiges leisten kann, wenn sie seriös ist, mithin ihr menschliches Anliegen ernst meint. Man muss sie dann aber auch nicht an der »hohen Kunst« messen, der es ja auch um extreme Formtransgressionen und -überwindungen geht. Man muss sie nach den Maßstäben ihrer Eigenlogik und ihres Selbstanspruchs bewerten.
Welche sind die hervorragenden Eigenschaften der nicht kulturindustriell geprägten populären Musik, mit denen sie Schmerz und Elend wahrhaftig ausdrücken kann? Sicher ist es oftmals – etwa bei Genres wie Blues oder Irish Folk – die authentische Leiderfahrung der Musiker. Aber ist populäre Musik, die die innere Natur, die Triebe und Gefühle des Menschen mehr zu ihrem Recht kommen lässt als die vorwiegend auf Erkenntnis zielende, den Geist hypostasierende Kunstmusik, nicht geradezu prädestiniert, auch eine Sprache des Leidens zu sein?
Die herausragenden Eigenschaften der nicht kulturindustriell geprägten populären Musik sind nicht andere als jene, die jedes Kunstwerk zu einem guten bzw. vorbildlichen werden lassen: eine Stimmigkeit im Verhältnis von Form und Inhalt, von Aussage und Ausdruck, von Handwerk bzw. Können und Suggestivität. Insofern es um Schönheit geht, kommt vielleicht auch noch das hinzu, was kaum je wirklich berechenbar ist, sondern den Rezipienten unvorbereitet ästhetisch erfasst. Aber das herauszuheben, scheint mir trivial zu sein (vielleicht auch ein wenig tautologisch). Zu fragen ist vielmehr, wann populäre Musik in die Gefahr gerät, sich besagter Möglichkeiten zu begeben, und das geschieht stets, wenn sie im Hinblick auf ihre Kommerzialität, mithin allzu leichte Konsumierbarkeit produziert wird. Denn wenn sie dem potentiellen Rezipienten allzu gefällig sein will, kann sie leicht den Verrat an ihrer Autonomie, an ihren ureigensten Möglichkeiten begehen. Das mag dem Konsumenten zwar »gefallen«, aber er wird dabei der Chance beraubt, Neues, Wesentliches, ja auch den Ausdruck seines Innern zu erfahren.
Was wahrhaftige populäre Musik und Kunstmusik verbindet: Künstler beider Sphären haben sich intensiv mit dem Phänomen Weltschmerz auseinandergesetzt. Ein beeindruckendes Beispiel aus dem Bereich Pop ist Anne Clark: »Soldiers in uniforms of nudity march over open hearts / Sweetly and sickly scented by roses / And your world is crushing you like those flowers / By scripts written into your skin with the ink of thorns«, heißt es in ihrem Stück »Weltschmerz« – was genau ist das eigentlich? Mit welcher mentalen Disposition und Geistesgeschichte ist Weltschmerz verbunden?
»Weltschmerz« ist ein Begriff, den die deutsche Romantik geprägt und verwendet hat, um das eigene Leid zugleich als das Leiden an der Welt zu bezeichnen. Abgesehen von der eigenen tiefen Traurigkeit und der aus ihr sich ableitenden Melancholie wird dabei die Unzulänglichkeit der Welt als Ursache des eigenen Leids apostrophiert. Daraus ergibt sich eine im Wesen pessimistische Weltsicht, mithin eine pessimistische Auffassung von Kultur. Diese romantische Grundhaltung ist auch in die Philosophie eingegangen, allen voran ins Denken Arthur Schopenhauers. Er postuliert einen allgegenwärtigen Willen, der keinen logischen Kategorien subsumiert werden kann, ein Wille, der im Individuum wie in Kollektiven, in der organischen wie in der anorganischen Natur, ja im gesamten Weltall unendlich wirkt, ein ewig »wollender Wille«. Der Mensch, der von diesem Willen immer angetrieben wird, sieht sich aber einer Realität ausgesetzt, die die Befriedigung des Willens, seine Erfüllung immerfort verhindert. Denn selbst dort, wo er momentan zur Ruhe gelangt ist, erwacht der Wille sogleich wieder, um den Menschen von neuem anzutreiben. Aus dieser wesenhaften Diskrepanz zwischen dem immerwährenden Wollen und der permanenten Frustration kommt der Mensch bei Schopenhauer nicht heraus. Daraus leitet sich bei ihm der sogenannte Kulturpessimismus ab. Denn nichts, letztlich auch nicht die von Schopenhauer erwogene Verneinung des Willens führt aus diesem Teufelskreis heraus. Einiges davon ist späterhin in das Denken Freuds als unüberwindbare Diskrepanz zwischen dem Lust- und dem Realitätsprinzip eingegangen, namentlich in seine Auffassung eines »Unbehagens in der Kultur«.
Nun steckt im Leiden ein starker Impuls, der nicht nach Kontinuität oder gar Resignation strebt, sondern eine radikale Veränderung einfordert: »Weh spricht: Vergeh!«, sagte Nietzsches Zarathustra. Somit wohnt dem Leiden selbst ein progressives Moment inne, das sogar revolutionäres Bewusstsein entfalten kann. Der entsetzte Aufschrei beim Empfinden von heftigem physischem oder psychischem Schmerz oder angesichts eines schockierenden Ereignisses, etwa einer extremen Gewalttat, findet sich in der Musik häufig verarbeitet – etwa im Black Metal oder Hardcore. Ein Bespiel aus der Kunstmusik ist der ohrenbetäubende »Schreiklang« nach einer Generalpause von apokalyptischen sieben mal sieben Sekunden in der Schluss-Szene der Oper »Die Soldaten«. Kann der Kunstmusik und auch authentischer populärer Musik (mit dem Blues als Keimzelle ihrer modernen Form, dessen DNA ja aus Leiderfahrung besteht) – beide sind nicht zuletzt auch »Bewusstsein von Nöten«, wie es Adorno in Anlehnung an Hegel formulierte –, nicht eine herausragende Bedeutung als Motor von Emanzipation zukommen? Schließlich gilt, »Leiden beredt werden zu lassen, ist Bedingung aller Wahrheit«.
Zunächst, und das sollte hervorgehoben werden, muss man sich den Motor von Emanzipation nicht ausschließlich als Antrieb aus der Not vorstellen, sondern nicht minder auch als die Anziehung, die von einer befreiten Zukunft ausgeht. Das war stets ein Fehler der orthodoxen Kommunisten, dass sie die Askese als Gerechtigkeitsideal darstellten – als hätten nicht sowohl Heine als auch Marx das gute Leben als Ideal der Freiheit (mit) angepriesen. Andererseits gilt für beides – für die Not als Antrieb und für das gute Leben als Anziehung –, dass sie sich auf das schlecht Bestehende beziehen. Und es gilt in diesem Zusammenhang, das Leid muss beredt gemacht werden, um den Willen zur Ausrichtung auf emanzipative Praxis anzukurbeln. Hierbei muss aber unterschieden werden: Der Schrei des real Leidenden ist etwas anderes als der Bühnenschrei eines das Leid Darstellenden. Was beredt gemacht wird (das Leid), wird mit den Mitteln der Kunst beredt gemacht, also vermittels des Als-ob. Und da muss Kunst immer aufpassen. Sie darf nicht mit dem Leben »konkurrieren«, sonst verfällt sie unweigerlich ins Pathos und in die Sentimentalität. Mutter Courage auf der Bühne ist eine Parabel für den Grundzustand des Menschen, der die Strukturen seiner eigenen Leiderfahrung mitbefördert. Als Parabel ist sie nur bühnenreal, nicht real. Und so sehr Mutter Courages »stummer Schrei« ergreifen mag, er wird stets nur Symbol des realen Schreis bleiben dürfen. Populäre Musik muss sich in dieser Hinsicht besonders vorsehen.
Das Interview lesen Sie in der M&R 6/2014, erhältlich ab dem 31. Oktober 2014 am Kiosk, im Bahnhofsbuchhandel oder im Abonnement. Die Ausgabe können Sie auch im M&R-Shop bestellen.
Ähnliche Artikel:
Anzeigen




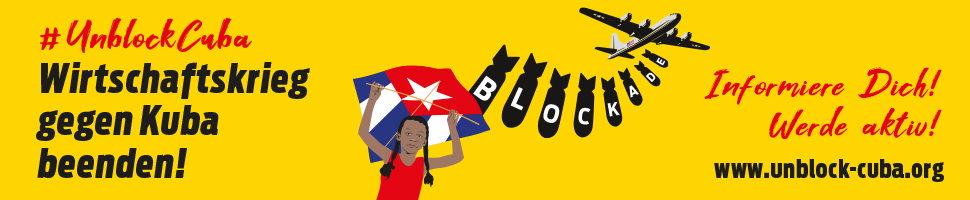

 Fotos von Katja Koschmieder und Jens Schulze
Fotos von Katja Koschmieder und Jens Schulze








