
Kinder auf dem Marktplatz eines galizischen Schtetls (1910)
Foto: Picture-Alliance / Imagno / Franz Hubmann
Juden, Judentum und Musik – im Spannungsfeld des Diasporischen und Nationalen
Das Thema Juden bzw. Judentum und Musik ist vorbelastet. Erörtert hat es zum ersten Mal (pseudo)theoretisch Richard Wagner im 19. Jahrhundert. Was er dabei zuwege brachte, war eine der bissigsten antisemitischen Schriften, die in der Frühzeit des modernen Judenhasses entstanden sind. So voller Vorurteile, klischee- und ressentimentgeladen indes Wagners Polemik war, muss herausgestellt werden, dass ihr ein historisches Wahrheitsmoment innewohnte. Denn der Topos »Judentum in der Musik« war letztlich nicht von der Grundfrage zu lösen, die das Judentum selbst im 19. Jahrhundert umtrieb, namentlich die als »das jüdische Problem« apostrophierte Frage nach der Stellung der Juden in der infolge der industriellen und der Französischen Revolution und unter dem Einfluss der europäischen Aufklärung im Westen sich hegemonial etablierenden bürgerlichen Gesellschaft. Die aus den Ghettos und dem osteuropäischen Schtetl-Dasein sich emanzipierende Judenheit war bestrebt, sich an ihre Residenzgesellschaften zu assimilieren und zu integrieren – eine Tendenz, die sich nicht nur auf das ökonomische, soziale und politische Leben der Juden auswirkte, sondern eben auch auf ihr geistiges und kulturelles. Und weil »die Rückkehr in die Geschichte« vom Bedürfnis, Entbehrtes schnell und intensiv zu kompensieren, angetrieben war, vollzog sich sehr bald eine Dialektik des Emporkommens: Während die akkulturierten Juden sich immer präsenter und dominanter im künstlerischen und kulturellen Leben ihrer jeweiligen Gesellschaft hervortaten, war man antisemitisch bestrebt, ihnen ihr »Jüdisches« vorzuhalten, mithin – besonders deutlich Wagner – ihnen eine genuine Schaffenskraft prinzipiell abzusprechen. Dass Juden wenig präsent waren in den zentralen Bereichen der schöpferischen Kunstpraxis, hing mit archaischen religiösen Vorgaben (etwa dem jüdischen Bilderverbot) und historischen Ausgrenzungsbedingungen zusammen; dies ließ man jedoch außen vor: Was im Reproduktiven zwangsläufig anerkannt werden musste, stellte man im Produktiven in Abrede. Hervorragende jüdische Geiger und Pianisten? Ja, ohne Zweifel. Nicht aber jüdische Maler und Komponisten.
Wesentlich Jüdisches?
Und doch erhebt sich auch unter Ausblendung der antisemitischen Demagogie die Frage, was unter »jüdischer Kultur«, unter »jüdischer Literatur«, unter »jüdischer Musik« oder »jüdischer bildender Kunst« zu verstehen ist. Eine konventionelle Definition geht davon aus, dass eine Kultur für jüdisch zu erachten sei, wenn sie von Juden gemacht ist. Entsprechend würden Mendelssohn, Heine, Marx, Freud, Einstein, Mahler und Modigliani der westlichen jüdischen Kultur des 19. und 20. Jahrhunderts zugezählt werden. Eine solche Definition würde die Frage außer Acht lassen, ob der betreffende Künstler oder Intellektuelle sich selbst als Jude angesehen hat oder ob ihm sein Judentum unter repressiven historischen Umständen gegen seinen eigenen Willen aufgezwungen worden ist. Eine andere Definition von Kultur als »jüdisch« bietet sich an, wenn sie Juden, Judentum bzw. – allgemeiner – jüdische Materialien zum Gegenstand hat; eine solche Definition würde Einstein ausnehmen, aber auch Zweifel hinsichtlich der schieren Existenz einer jüdischen Dimension im Werk von Mendelssohn, Mahler oder Modigliani und im Hinblick auf den sehr spezifischen Zugang zum jüdischen Motiv im künstlerischen bzw. philosophischen Werk von Heine, Marx und Freud aufkommen lassen.
Von selbst versteht sich dabei, dass eine solche Definition zwangsläufig nichtjüdische Künstler, die sich mit »jüdischen Materialien« befasst haben, einschließen würde. Eine andere Definition von Kultur als »jüdisch« ist gegeben, wenn sie durch etwas wesentlich Jüdisches gekennzeichnet ist, wie etwa die katholische Messe die christlich-religiöse Musiktradition der westlichen Neuzeit unverwechselbar charakterisiert. Hervorgehoben sei dabei, dass das Postulat des »Jüdischen« nicht nur die Heilige Schrift und das jüdische Gebetsbuch betrifft, sondern sich auf eine erkennbare jüdische Eigentümlichkeit bezieht, welche über die religiös-liturgischen Quellen hinausgeht. Denkbar ist zudem eine Definition, die alle oder einige der hier aufgeführten Möglichkeiten miteinander verbindet. Und doch scheint es nahezu unmöglich zu sein, eine umfassend verbindliche Definition von »jüdischer Kultur« anzubieten. Dies hat primär mit dem Verlauf der jüdischen Geschichte als einer Exilgeschichte zu tun, nicht minder aber auch damit, dass die Definition des Juden und des Judentums als einer homogen vereinheitlichenden Kollektivkategorie im Zeitalter beschleunigter Säkularisierung und zunehmender Desintegration des jüdischen Nationalismus in seiner klassischen zionistischen Form schon längst nicht mehr selbstevident ist. Wenn überhaupt, lässt sich eine kohäsiv wirkende jüdische Identität am ehesten übers Negative anzeigen – einen durch den ehemals religiös entfachten Verfolgungsdruck und den säkularen Antisemitismus der Moderne motivierten Zusammenhalt der Juden.
Das diasporisch Hybride
Wie sind vor solchem Hintergrund herausragende jüdische Vertreter der Avantgarde im 20. Jahrhundert, etwa Arnold Schönberg und Marc Chagall, einzuschätzen? Sie waren Juden nach ihrem Selbstverständnis: Bei Marc Chagall ist darüber nie Zweifel gehegt worden, beim zunehmend assimilierten Schönberg vollzog sich, ausgelöst durch die Naziverfolgung und das oktroyierte Exilleben, eine Rückkehr zum Judentum. Chagalls Werk ist von jüdischen Motiven, vor allem denen des osteuropäischen Schtetl-Judentums, beseelt und durchwirkt. Schönberg widmete ein herausragendes Werk dem Holocaust (»Ein Überlebender aus Warschau«), und seine unvollendet gebliebene Oper »Moses und Aron« befasst sich mit zwei zentralen Gestalten des Alten Testaments und einem fürs Judentum konstitutiven Schlüsselereignis. Haben aber die von ihnen eigentümlich angewandten Ausdrucksmittel – etwa Chagalls bemerkenswerter Kolorismus und die Atonalität in der Musik Schönbergs – etwas mit ihrem Judentum zu tun? Wohl kaum. Hat vielleicht das schier Innovative ihres Werks, die epochale Revolutionierung ihres Mediums etwas Jüdisches?
Auch kaum. Zwar waren Juden in sozialrevolutionären Bewegungen nicht zuletzt aus »jüdischem Interesse« an der Veränderung der Gesellschaft sehr prominent beteiligt und vertreten, aber kann man ernsthaft behaupten, dass die Revolutionierung von Kunst und Musik einem jüdischen Impuls entstammte? Und gab es traditionell in der jüdischen Kultur etwas, das diesen Impuls vormalig indiziert hätte? Nein, die Kunstavantgarde des 20. Jahrhunderts war ganz gewiss kein spezifisch »jüdisches« Anliegen. Insofern Juden an ihr herausragend beteiligt waren, verdankte sich das gerade ihrer produktiv sich auswirkenden hybriden Situation, mit der sie als schöpferische Künstler konfrontiert waren: Strukturell erwies sich die Vermengung des in der jüdischen Lebenswelt Geformten mit der Ambition, sich im nichtjüdischen Kulturfeld zu betätigen (und vielleicht auch zu beweisen), als äußerst fruchtbar. Das diasporisch Hybride machte gerade den jüdischen Aspekt ihrer Kunst aus. Es wird kein Zufall gewesen sein, dass es die Juden George Gershwin und Leonard Bernstein waren, die die kunstvolle Übersetzung des schwarzen Jazz ins Sinfonische vollbrachten, wie sich denn nicht von ungefähr Aaron Copland als einer der bedeutendsten Komponisten der US-amerikanischen Moderne erwies.
Neuhebräische Kultur
Vor ein ganz anderes kulturelles Problem sah sich die Judenheit der Moderne gestellt, als sie sich dem Zionismus als nationaler Lösung des »jüdischen Problems« verschrieb. Im Gegensatz zu allen anderen Nationalstaatsbildungen in Europa war der Zionismus anfangs weder im Besitz eines Territoriums zur Errichtung eines Staates noch im Besitz einer soziologisch homogenen Kollektivität zur Besiedlung des Territoriums; entsprechend war er auch nicht Sachwalter einer bestehenden nationalen Kultur. Denn gerade die Kultur der jüdisch-diasporischen Lebenswelten trachtete der Zionismus negierend zu überwinden: Das Diasporische galt ihm als verwerflich, als degeneriertes jüdisches Dasein. Man sah sich zu Beginn der zionistischen Bewegung also vor die Aufgabe gestellt, die »Erneuerung der Kultur des jüdischen Volkes« zu vollziehen. Das bedeutete aber nichts anderes, als sie erst eigentlich zu erschaffen. Das galt nicht nur für die Nationalsprache, welche auch erst umkämpft und, als die Wahl aufs Hebräische fiel, belebt und erneuert werden musste, sondern betraf letztlich alle Bereiche der Kultur. Es bestand zunächst weder eine zionistische Hochnoch eine Volks- bzw. Populärkultur. Und so begann man sie zu schaffen.
Dass dabei die aus Europa nach Palästina eingewanderten Juden die Kultur ihrer jeweiligen Heimatländer mitbrachten, sollte sich entscheidend auf die Grundlegung der neuhebräischen Kultur auswirken, allen voran im musikalischen Bereich. Nicht von ungefähr ist das hebräische Liedgut der vorstaatlichen Ära dominant vom russischen Melos geprägt. Und da man mit der kulturellen Pionierarbeit auch einen nachgerade missionarischen Auftrag verbunden sah, setzten sich hochkarätige Komponisten und Musiker für eine qualitativ hervorragende Vertonung von (wie immer ideologisch eingefärbter) literarisch hochwertiger Lyrik ein. Gerade weil man nicht auf ein »Wunderhorn« voller Volkslieder zurückgreifen konnte (bzw. durfte), entstanden dabei meisterhafte Werke des hebräischen Gesangs – aus der zionistischen Not der Diaspora-Negation erwuchs die Tugend einer erstklassigen, letztlich präzedenzlosen Liedkultur, die erst nach der Staatsgründung durch kommerzielle Schlagerproduktion und ab den 1960er-Jahren durch westlich geprägte Popsongs nach und nach abgelöst werden sollte.
Zweierlei wurde dabei – bewusst oder auch nicht ganz bewusst – vernachlässigt bzw. ausgegrenzt. Zum einen die musikalische Folklore des diasporischen Judentums Osteuropas, mithin die im heutigen Deutschland so beliebte Klezmer-Musik. Über Jahrzehnte fristete sie in Israel ein separiertes Dasein in den (antizionistischen) Lebenswelten des orthodoxen Judentums bzw. späterhin im Liedgut der nationalreligiösen Siedlerbewegung, quasi als nationalistisches Veto gegen den westlich beeinflussten, säkularisierten Pop, der die Radio- und Fernsehsender zu dominieren begann. Erst Ende der 1960er-Jahre besann man sich im liberal-säkularen Israel wieder auf die chassidische Musikkultur. Neben vielen anderen Liedwettbewerben etablierte sich sogar ein »Festival des chassidischen Gesangs«.
Zum anderen aber dauerte es Jahrzehnte, ehe der sogenannte »orientalische Gesang« Eingang in die Sphäre der israelischen Songhegemonie finden konnte. Bedingt durch die historische Reihenfolge der in (Eretz) Israel eingewanderten jüdischen Ethnien war der musikalische Konsens von der Liedkultur der aus Europa gekommenen Juden bestimmt und geprägt. Nicht von ungefähr
konnten sich viele israelische Intellektuelle orientalischer Abstammung in den 1980er-Jahren über nichts mehr erbosen als über die, wie sie meinten, »von oben« bzw. von aschkenasischen Inhabern offizieller Machtpositionen systematisch gesteuerte Unterdrückung des »orientalischen Gesangs« und dessen offensichtlichen Ausschluss aus den Musikprogrammen der Massenmedien. Noch in den späten 90er-Jahren stellte einer ihrer herausragenden Vertreter »den langen Weg« zur Erlangung eines wahrhaftigen Friedens, der durch die israelische und palästinensische Arbeiter ausbeutenden Betriebe in Israels Kleinstädten und im Gazastreifen führe, auf die gleiche Ebene mit »dem langen Weg, der durch die Keller der Unterdrückung der orientalischen Kultur in den staatlichen und ›privaten‹ Sendeanstalten führt«.
Wie man das Jüdische an jüdischen Komponisten von Kunstmusik feststellen soll, ist noch immer eine nicht leicht zu beantwortende Frage. Was sich in dieser Hinsicht in Israel gebildet hat, ist die in der prästaatlichen Ära mit Mitteln der europäischen Kompositionstradition verfolgte Bestrebung, eine genuine israelische bzw. in den Mittelmeerraum zu integrierende Musik entstehen zu lassen, ein Versuch, der aber letztlich scheiterte, solange er sich der außermusikalischen Ideologie verschrieb. Man kam über »Weimar in der Wüste« nicht hinaus, wie man das Phänomen späterhin sloganhaft verdichtet nannte. Spielt der Topos »Juden in der Musik« außerhalb Israels heute noch eine Rolle? Wenn man vom deutschen Klezmer-Fetischismus einmal absieht, wohl keine allzu gravierende.
Den Artikel lesen Sie in der Melodie und Rhythmus 5/2016, erhältlich ab dem 2. September 2016 am Kiosk, im Bahnhofsbuchhandel oder im Abonnement. Die Ausgabe können Sie auch im M&R-Shop bestellen.
Ähnliche Artikel:
Anzeigen



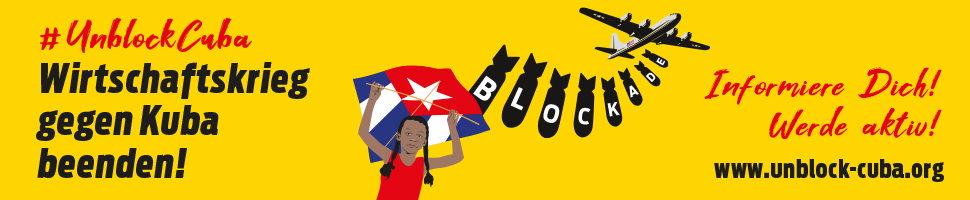

 Fotos von Katja Koschmieder und Jens Schulze
Fotos von Katja Koschmieder und Jens Schulze








