
Über der Musikindustrie ballen sich dunkle Wolken zusammen
Trent Reznor ist ein Freund klarer Worte. Der Frontmann der Nine Inch Nails warnte am 14. Juli seine Fans per Twitter vor dem Kauf der Wiederveröffentlichung seiner Platte »Pretty Hate Machine«: »A record label bullshit move repackaging the old version. Ignore please.« Im Original ist die Platte 1989 erschienen. Das Label hat sie 2011 als Reissue in neuer Verpackung auf den Markt geworfen. Das kostet nicht viel Geld, ist aber gut für den Umsatz, wenn die Fans zugreifen.
Dabei wäre nichts dagegen einzuwenden, wenn 29 Jahre nach Markteinfühung der Compact Disc das Angebot an CDs steigen würde, auf denen die Musik nicht so klingt, als hätte man sie in einer leeren Gießkanne aufgenommen. Die stümperhaften Remaster bleiben aber am Markt. Sie werden nur umetikettiert – oder verschlimmert. Beispiel: The Doors. Am 8. Juli erschien eine Collection mit allen sechs Studioalben, verpackt in dürren Papphüllen (»authentisch replizierte Papierschuber «, schreibt der Promotexter), die in einem Pappkarton stecken (»aufwändig gestaltete Box«). Selbstverständlich wurden alle Songs 2005 »von Bruce Botnik und The Doors neu gemischt und remastert«. Resultat: Eine f lau klingende Musik, der jene Tiefe und Dynamik fehlt, die auf den Remastern von 1999 noch zu hören war. Schlechtere Qualität zum gediegenen Preis. Der Doors-Fan zahlt, und Warner lacht.
Die vorläufige Krone im Reissue-Zirkus gebührt Universal. Zum 20. Jubiläum der Nirvana-Platte »Nevermind « veröffentlicht der Weltmarktführer eine Super Deluxe Edition mit vier CDs: dem selbstverständlich remasterten Album und »zahlreichen bisher unveröffentlichten Aufnahmen, seltenen B-Seiten, alternativen Mixen, Radiosessions und seltenen Studio- und Liveaufnahmen (einschließlich dem kompletten Halloween-Konzert im Paramount Theatre in Seattle 1991)«. Halleluja! Die Mixe und Sessions (Boombox Rehearsals und Devonshire Mixes) sind so entbehrlich wie ein Furunkel auf der Nase, aber der Rubel muss eben rollen.
Dass die Musikindustrie die Backkataloge mit immer neuen Tricks ausquetscht, beobachten die Bands mit Argwohn. Es ist ihre Musik, die bis zur letzten Bonus-Scheibe verwurstet wird und von deren Einnahmen sie nur einen relativ geringen Anteil erhalten. Doch das Blatt könnte sich wenden.
In den USA wurde 1976 ein Auf lösungsrecht per Gesetz eingeführt. Danach erhalten Musiker alle Rechte an ihren Werken zurück, die 35 Jahre oder älter alt sind. Am 1. Januar 1978 trat das Gesetz in Kraft, am 1. Januar 2013 beginnt es zu wirken. Bob Dylan, Bruce Springsteen, Tom Petty, Kris Kristofferson, Bryan Adams und Tom Waits wurden schon über ihre Anwälte aktiv. Die Musikindustrie reagiert nervös. Aus ihrer Sicht muss alles bleiben, wie es war, denn die Aufnahmen wurden nicht von individuellen Künstlern, sondern von Musikern geschaffen, die man als Angestellte betrachtete, die einen Lohn erhielten. Deshalb sollen die Rechte für alle Songs für alle Zeiten bei den Labels bleiben. Dass der Lohn ein Vorschuss war, der mit den Produktionskosten verrechnet wurde, verschweigen die Label. Das Geschäft mit den Reissues soll weitergehen.
Jürgen Winkler
Der Beitrag erscheint in der melodie&rhythmus 5/2011, erhältlich ab dem 6. September 2011 am Kiosk oder im Abonnement.
Ähnliche Artikel:



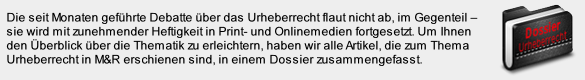


 Fotos von Katja Koschmieder und Jens Schulze
Fotos von Katja Koschmieder und Jens Schulze








