
Foto: Umberto Lopez
Asian Dub Foundation sind ein klassenkämpferischer Standpunkt und künstlerische Radikalität in der Musik wichtiger als aufgesetzte politische Botschaften
Interview: Maciej Zurowski, London
 Eigentlich wollten Asian Dub Foundation nur ein Benefizkonzert für asiatische Kids im Knast spielen und sich anschließend wieder auflösen. Doch dann entwickelte sich das 1993 gegründete Londoner Projekt, das aus mehreren Community-Workshops hervorging, zu einer richtigen Band. Ihre punkbeeinflusste Mischung aus Bhangra, Rap, Dub und vielen anderen Musiken klang wie eine Kriegserklärung an den trauten Britpop-Konsens, der Blairs »Cool Britannia« vorausahnte. Rassismus und Kolonialismus waren die Brennpunkte früher Werke wie »Facts and Fictions«. Elf Alben später hat sich die Gesellschaft Großbritanniens verändert: Auf dem am 10. Juli erscheinenden Longplayer »More Signal More Noise« erzählt »Zig Zag Nation« zum Beispiel davon, wie nationalistische Parteien nun auch mit dunkelhäutigen Kandidaten aufwarten, die gegen »Eindringlinge« aus Osteuropa hetzen. M&R sprach mit Steve Chandra Savale, dem Bandleader von Asian Dub Foundation.
Eigentlich wollten Asian Dub Foundation nur ein Benefizkonzert für asiatische Kids im Knast spielen und sich anschließend wieder auflösen. Doch dann entwickelte sich das 1993 gegründete Londoner Projekt, das aus mehreren Community-Workshops hervorging, zu einer richtigen Band. Ihre punkbeeinflusste Mischung aus Bhangra, Rap, Dub und vielen anderen Musiken klang wie eine Kriegserklärung an den trauten Britpop-Konsens, der Blairs »Cool Britannia« vorausahnte. Rassismus und Kolonialismus waren die Brennpunkte früher Werke wie »Facts and Fictions«. Elf Alben später hat sich die Gesellschaft Großbritanniens verändert: Auf dem am 10. Juli erscheinenden Longplayer »More Signal More Noise« erzählt »Zig Zag Nation« zum Beispiel davon, wie nationalistische Parteien nun auch mit dunkelhäutigen Kandidaten aufwarten, die gegen »Eindringlinge« aus Osteuropa hetzen. M&R sprach mit Steve Chandra Savale, dem Bandleader von Asian Dub Foundation.
Als Sie die Band gründeten, prägten »ethnische Spannungen« den Londoner Osten: Die British National Party kämpfte in den Straßen, und es gab viele rassistische Übergriffe. Was hat sich seitdem geändert?
Der 11. September 2001 hat zu einer Spaltung in der asiatischen Community geführt, deren eine Hälfte jetzt vor allem mit dem Islam assoziiert wird. Es ist eine sehr spezielle Art der Xenophobie, die sich durch eine globale Perspektive auszeichnet und politische Sachverhalte verzerrt wiedergibt. In Wirklichkeit verläuft die vorderste Front im Kampf gegen den Islamismus quer durch den Islam selbst: z. B. im Irak und in Afghanistan, wo der Wahhabismus den älteren toleranteren Sufismus bedrängt. Zudem werden viele junge Leute überhaupt erst jetzt zum Islamismus bekehrt. Das hat für mich wenig mit Religion zu tun, sondern damit, dass eine totale Lösung für entsetzliches Unrecht präsentiert wird, von dem es ja nun wirklich genug zu sehen gibt. Das Versagen der Linken in der Dritten Welt ist bestimmt mit ein Grund dafür, dass junge Leute sich dem Islamismus zuwenden – obwohl der ja im Kampf gegen die UdSSR und verbündete Nahoststaaten maßgeblich von den USA gefördert wurde. Heute präsentiert er sich als die einzige ernst zu nehmende Macht gegen die Brutalität des Westens.
Welches Großbritannien der 90er haben Sie in Erinnerung? Ein Land, in dem der Begriff »Multikulturalismus« Teil des ideologischen Mainstreams wurde? Oder Oasis, Chauvinismus und Union Jacks ohne Ende?
Im Gegensatz zu den großen musikalischen Bewegungen zuvor – ob Psychedelic, Punk oder Acid House – war Britpop musikalisch wie kulturell völlig regressiv. Die radikale neue Musik aus den Innenstädten hieß Jungle, aber den Medien waren Britpop und Nostalgie freilich lieber. Wir haben diesen Mist gehasst. Und was heißt schon »Multikulturalismus«? London ist ohnehin multikulturell – darüber muss man nicht groß reden. »Multikulturalismus« dagegen ist eine bürokratische Ideologie. Dabei geht es um Alibi-Aktionen und Eigennutz durch Abgrenzung. Zudem bleibt jeglicher Klassengedanke auf der Strecke, und der ist uns wichtig – auch in der Musik. Wir sind wahrscheinlich eine von wenigen Londoner Bands aus der Arbeiterklasse, die noch einen Plattenvertrag haben.
Läuft man Gefahr, einen Radical Chic zu bedienen, wenn man Pop mit politischen Gesten verbindet?
Ich finde nicht, dass klare politische Aussagen die Glaubwürdigkeit des Künstlers beeinträchtigen. Am wichtigsten ist aber die Musik. Man sollte Musiker eher als Medien betrachten, die verschiedene Einflüsse kanalisieren. Ihre politische Meinung ist dabei unwichtig. Siehe The Stooges: radikale Musik, auch wenn Iggy Pop ein Konservativer ist. Umgekehrte Beispiele gibt es auch zur Genüge. Am schönsten ist es aber, wenn der musikalische Ausdruck der Besitzlosen auch noch innovativ ist. Grime war der Soundtrack der Londoner Sozialsiedlungen – gewalttätig und echt, aber auch musikalisch bahnbrechend. Es war ein ganz neuer Dialekt im Rap, der dessen amerikanischen Wurzeln völlig verwarf. Politisch korrekt waren die Texte natürlich nicht, aber Grime war zweifelsohne radikal.
Zudem gibt es viele Beispiele für Musik, die tatsächlich radikalen sozialen Wandel begleitet hat. Man muss nur weniger eurozentrisch sein, um sie zu finden. Haben Sie meine Sendung »Music of Resistance« auf Al Jazeera gesehen? Als ich in Mali war, konnte ich es kaum glauben: Die Musiker von Tinariwen waren früher Guerillas und haben ihre Musik ganz gezielt zur Mobilisierung ihrer Kampfgefährten eingesetzt. Andere Muslime haben angedroht, ihnen die Finger abzuhacken, falls sie Gitarre spielen. Sie haben Schussnarben. Mali war das ärmste Land, das ich in meinem Leben gesehen habe, und die Musik von Tinariwen hat dort ganz direkt politische Kämpfe begleitet und sogar inspiriert. Niemand kann mir erzählen, dass Musik keine Wirkung hat.
Wie stehen Sie zur sogenannten Weltmusik?
Mit dem Begriff assoziiere ich einen überwiegend zahmen, harmlosen Trend der 80er. Nur zwei oder drei Stile galten als Weltmusik. Was heißt das schon? Alles ist Weltmusik, sogar Britpop – und auch Weltmusik wird von westlichen Stilen beeinflusst. Hören Sie sich nur Spoek Mathambo aus Südafrika an. Er hat ein Cover von »She’s Lost Control« (Joy Division) aufgenommen, das wie eine Mischung aus Grace Jones und elektronischer Musik aus den Townships klingt. Oder Konono Nº1 aus dem Kongo – gewiss keine gemütliche Weltmusik, sondern authentischer Innenstadt-Sound.
Stellt der Konsum indigener Musik im Westen eine neokoloniale Praxis dar?
Die Behauptung, dass musikalische Erkundung neokolonial sein soll, finde ich eher albern. Wenn Sie sich heute Abend Tinariwen anschauen, interessieren Sie sich dafür, was sie zu sagen haben, oder wollen Sie nur die Kopfbedeckung kaufen? Vermutlich ersteres. Das Problem ist eher, dass sich nicht genug Leute für solche Musik interessieren. In den frühen 80ern hat der New Musical Express (NME) gerne über Afro-Dub und Afro-Funk geschrieben. Die Leute wollten trotzdem nur ihre Indie-Bands hören, also wurde aus kommerziellen Gründen der Kurs gewechselt.
Und wenn sich westliche Musiker sogenannter indigener Musik bedienen – ist das Diebstahl?
Aber nein. Schlechter Geschmack höchstens – wobei es natürlich darauf ankommt, wie man es angeht. Wenn man nur oberflächliche Aspekte kopiert und auf den exotischen Appeal setzt, dann ist das Exotismus. Das finde ich aber nicht beleidigend, sondern eher belustigend. Auf mich wirkt das wie die Hippie-Bands der 60er mit ihren Zither-Einlagen. Trotzdem geht es in der Musik oft um Rekontextualisierung. Ich habe selber ein paar neue Stücke komponiert, die auf weitgehend unbekannter Musik aus aller Welt basieren. Sampling ist systematische Aneignung fremder Quellen, und gewissermaßen wurde in der Musik schon immer »gesampelt«. Es kann aber auch ein Problem sein. Ich will ein Beispiel nennen: In Indien wurde eine ganze Wirtschaftsenklave für Goa-Trance-Hippies eingerichtet, um deren Vorstellungen von Indien zu genügen. Die Einheimischen tragen Shiva-T-Shirts und legen den ganzen Tag Trance auf, um Geld zu verdienen. Da wird nicht nur ein ekliges Mittelschichts- Hippie-Zerrbild von Indien projiziert, sondern örtliche Hotels leiten auch noch Wasser aus Dörfern um, wo die Leute mittlerweile am verdursten sind. Alles nur, um die Touristen bei Laune zu halten, von denen sich die lokale Wirtschaft abhängig gemacht hat.
Wie hat die britische Musikpresse am Anfang auf Asian Dub Foundation reagiert – fand sie Ihre Band musikalisch und thematisch unterstützenswert oder eher bedrohlich?
Das wäre schön, wenn es so einfach wäre: Musikjournalisten verstehen und unterstützten einen! In Wirklichkeit geht es darum, was sich am besten vermarkten lässt, welche PR-Abteilung am besten zahlt und wer das meiste Kokain herausrückt. Der NME wurde nur deswegen auf uns aufmerksam, weil ihnen Bobby Gillespie von Primal Scream sagte, dass wir die beste Live-Band der Welt seien. Dann schrieben sie auch über uns – aber nur zwei, drei Jahre lang.
Das Interview lesen Sie in der Melodie und Rhythmus 4/2015, erhältlich ab dem 26. Juni 2015 am Kiosk, im Bahnhofsbuchhandel oder im Abonnement. Die Ausgabe können Sie auch im M&R-Shop bestellen.
Ähnliche Artikel:
Anzeigen


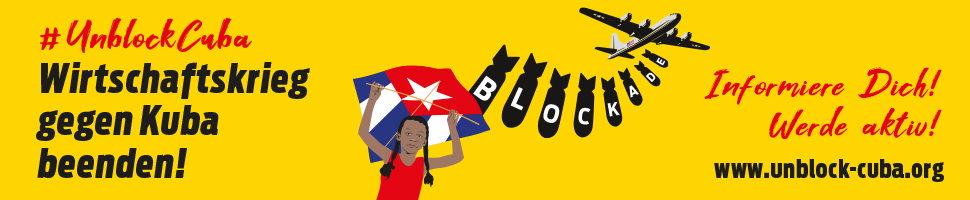

 Fotos von Katja Koschmieder und Jens Schulze
Fotos von Katja Koschmieder und Jens Schulze








