
Fotos v.l.n.r.: Christopher Prentiss Michel, Simon Mccreery, DPA, public domain, DPA
Warum nur der Neoliberalismus den Hipster hervorbringen konnte
Matthias Rude
Der Song »Berlin Mitte Boy« war die erste und einzige Veröffentlichung der gleichnamigen Band, einer kurzlebigen Formation um den Frontpage-Herausgeber Jürgen Laarmann. Die Cover-Version des Titels »New York City Boy« von den Pet Shop Boys beginnt mit den Zeilen: »London is teuer / Paris is scheiße / New York ist retro, auf seine Weise / Es gibt einen Ort, der kickt total / Wenn Du nicht dabei bist / ist Dein Leben ‚ne Qual«. Tobias Rapp, Autor des Buchs »Lost and Sound. Berlin, Techno und der Easyjetset«, meint im Rückblick: »Der Charme des Songs bestand damals in der unglaublichen Anmaßung. Im Jahr 2000, als er erschien, war es ein Witz, Berlin mit New York, Paris und London in eine Reihe zu stellen, gar ›Hackescher Markt statt Broadway‹ zu singen. Das hatten die Politiker gemacht, die Berlin nach dem Mauerfall ins Konzert der Großmetropolen reden wollten, die auf den riesigen Boom gehofft und dabei gigantische Schuldenberge angehäuft hatten. Oder konservative Intellektuelle, die auf die Wiederauferstehung preußischer Gloria hofften. Sonst niemand.«
Außer: Hipster. Die werden, das jedenfalls schreibt Tobias Kunow in seinem 2014 erschienenen Debütroman »Hipsterfreie Zone: Keine Macht den Jutebeuteln!«, in dem er die verhärteten Fronten der Berliner Szene-Kulturen aufs Korn nimmt, als Vorboten der Gentrifizierung gefürchtet: »Parasitär annektieren sie Lebensräume von Künstlern und Kreativen, zerstören deren Lebensgrundlage, indem sie qua Masse und Sorglosigkeit die Mietpreise nach oben treiben, und geben deren Produkte und Errungenschaften für ihre eigenen aus. Sobald die Hipster einen Stadtteil befallen haben, ist dieser noch lange nicht tot, aber oft ist es für ihn dann zu spät. Verbreitungsgebiet: Städte der westlichen Welt. Hauptstadt der Hipster-Bewegung: momentan Berlin, demnächst vielleicht Istanbul, Tel Aviv, Reykjavík oder Bottrop, wer weiß das schon. In seinem Erscheinungsbild liebt der Hipster Uniformität. Laut Internet sind Skinny-Jeans, Chucks, Brille mit schwarzem Gestell und ein Jutebeutel fester Bestandteil des Hipster-Outfits. Weibliche Hipster tragen dazu gerne einen Dutt.« Man erkennt ihn jedenfalls, wenn man ihn sieht. Aber natürlich gleicht keiner genau dem anderen – schließlich ist der Individualismus, um nicht zu sagen: die Rebellion gegen Mainstream und Massenkonsumkultur ja gerade das, was den Hipster ausmacht. Er ist »zumindest im Konsum ein Rebell«, so der Jugendkulturforscher Philipp Ikrath in seinem gerade erschienenen Buch »Die Hipster. Trendsetter und Neo-Spießer«.
Nur: Inzwischen werben sogar Städte mit ihrer Hipster-Freundlichkeit. Der Hipster ist zum Wirtschaftsfaktor geworden, der den Tourismus ankurbelt. Der »Hipsterguide Hamburg«, erstellt von der Hamburg Marketing GmbH, räumt auch den letzten Zweifel aus: Ein Hipsterleben in der Hansestadt ist unkompliziert – findet sich dort doch alles, was der Hipster gemeinhin zum Leben braucht: »Ein Tag kann möglichst umweltschonend mit pH-neutraler Seife und einer modischen Zahnbürste aus Bambus oder ökologisch abbaubarem Nylon aus dem Hamburger Onlineshop Hydrophil beginnen. Denn nachhaltiger Lifestyle ist wichtig, natürlich frei nach dem Motto: ›Rette die Welt und sieh gut dabei aus!‹« An einem Samstagmorgen biete sich die Schnäppchenjagd auf den Flohmärkten rund um die alte Rinderschlachthalle im Schanzenviertel an. In der benachbarten Marktstraße, wo Secondhand-, Designerund Hippieläden direkt nebeneinander liegen, ließe sich »der Shopping-Marathon« dann fortsetzen. Zum Brühkaffee – »Stichwort: Entschleunigung« – werden »hochwertige Indie-Printmagazine zum Blättern gereicht«. Am Schluss heißt es: »Und so endet ein Tag im Leben eines Hamburger Szenemenschen: Er und sie, Hand in Hand oder auf dem Rennrad dem Sonnenuntergang entgegen. Das Leben an der Elbe ist entzückend. Und angesagt. Eine Reise lohnt sich.« Dass die Hipster-Bewegung mehr und mehr im Mainstream, von dem sie sich als Subkultur vorgeblich distanzieren wollte, aufgeht, gar zum Marketing-Gag verkommt, überrascht allerdings niemanden. Schon die Teilnehmer einer Tagung, die die New Yorker Kulturzeitschrift n+1 dem Hipster im April 2009 an der New School in Manhattan gewidmet hat, analysierten, dass »Hipster« nur noch ein anderer Name ist für eine Figur, die man auch schlicht als »hippen Konsumenten« bezeichnen könnte. Er selbst schaffe per definitionem keine echte Kunst; vielmehr sei er »eine Person, die Konsumentscheidungen – das richtige T-Shirt, die richtige Jeans, das richtige Essen – als eine Kunstform versteht. Er bewegt sich dabei zwar innerhalb der Grenzen des Massenkommerzes, sucht aber dennoch nach Distinktion und Exklusivität«, so n+1-Redakteur Mark Greif. Der Hipster orientiere sich »sowohl an der subkulturellen Rebellion als auch an der Elite und reißt dadurch eine Kluft zwischen diesen Sphären auf, der giftige Dämpfe entströmen«.
Dass es sich bei dem Großteil der Menschen, die das Land bevölkern, das Greif als »Bohemia« bezeichnet, um Trittbrettfahrer, Poser, Kunstliebhaber und Fans handelt, ist keine neue Beobachtung. »Es lässt sich durchaus eine Brücke zwischen dem Bohemien vergangener Tage und dem Hipster der Gegenwart ziehen«, so Philipp Ikrath. Tatsächlich existierte der Hipster sogar wortwörtlich schon einmal. Seit dem frühen 20. Jahrhundert fand das Wort »hip« sich im »Jive-Talk«, dem Straßenslang der afroamerikanischen Jazzer. Ein weißer Boogie-Pianist und Sänger, geboren 1915 und aufgewachsen in der Bronx, machte den Begriff zu seinem Beinamen: Harry »The Hipster« Gibson. »They call him Handsome Harry, the Hipster« und »Every night you’ll find him around the club« singt er auf »Boogie Woogie in Blue« (1944). Dem Album war das kleine Glossar »For Characters Who Don’t Dig Jive Talk« beigelegt. Darin ist der Hipster als jemand definiert, der Hot Jazz schätzt. Ansonsten definierte er sich selbst wesentlich über die Eigenschaft der Hipness – in Abgrenzung zum »Square«, dem Spießer. Seine Musik war der Bebop. Er befand sich »im innersten und geheimsten Zirkel der Jazz-Kennerschaft«, schrieb Joachim-Ernst Berendt 1962 in der Zeitschrift Twen. Der Typus umfasste, so Steven Watson in seinem Buch »Die Beat Generation« (1995), »eine Gemengelage aus Existentialismus, Drogen und Jazz. Er bot Amerikas Beat Generation das am schärfsten gezeichnete Modell für den nonkonformistischen Bohemien«.
Als solchem wurde ihm damals einiges zugetraut. Für Norman Mailer etwa war die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg durch politische Stagnation und Konformismus geprägt. In der Beat Generation und im Hipster aber, den er als US-Pendant zum europäischen Existentialisten betrachtete, sah er Anlass zur Hoffnung. In seinem Essay »The White Negro« (1957) nennt er ihn »die rebellische Zelle im Körper unserer Gesellschaft« und war überzeugt: »Der Hipster ist der erste Hauch einer zweiten Revolution in diesem Land.« Das war, ganz offensichtlich, eine Fehleinschätzung: Aus der von Mailer antizipierten Revolution wurde nichts. Stattdessen verliert sich die Spur des Hipsters zu Beginn der 60er-Jahre irgendwo in den Bars der Lower East Side.
Aber: Totgesagte leben länger. In den späten 90ern tauchte, abermals in der Lower East Side, ein neuer Typ Hipster auf. Er ging aus dem 90er-Jahre- Lifestyle des Indie-Milieus hervor, das der Soziologe Richard Lloyd in seiner Ethnografie des Chicagoer Stadtteils Wicker Park als »Neo-Boheme« bezeichnet hat. Die neue Hipster-Subkultur aber hatte nichts mit Punk, Grunge, Rockabilly, Ska, Mods oder Hardcore zu tun – sie ist keiner bestimmten Musikrichtung mehr zuzuordnen, auch wenn sie sich aufgrund der Ablehnung von Mainstream-Musik nach wie vor im Indie-Bereich bewegt. Als eine der typischen Hipster-Bands wird immer wieder die britische Indie-Popband Belle and Sebastian genannt – aber natürlich ändert sich das ständig. »Ich stehe nur auf Tracks, die von euch keiner kennt / Die Klamotten, die ich trage, sind natürlich second-hand«, heißt es im Track »Ja ich bin Hipster« des Augsburger Rappers Errdeka.
Die neuen Hipster konnten sich auch nicht mehr auf die schwarze Straßenkultur beziehen, um sich vom Mainstream abzugrenzen – die war ja lange schon genau dort angekommen. Sie bedienten sich deshalb der fragwürdigen Ästhetik der weißen Unterschicht, des »White Trash«: Plötzlich sah man tätowierte Szenegänger mit Trucker-Kappen, altmodischen Feinripp-Unterhemden, Pilotenbrillen, Schnauzbärten, weißen Tennissocken und T-Shirts, wie man sie im US-amerikanischen Herzland trug. Genau wie der »White Negro« einst das Schwarze zu einem Fetisch gemacht hatte, beschworen die neuen Hipster die Welt der Trailer-Parks und des Countrysängers Merle Haggard, eine Welt, die eine rituelle, rohe Kraft ausstrahlte. Bei einem Blick hinter die Rebellen-Kostümierung zeigte sich oft genug die Fratze reaktionärer Politik. Etwa beim Vice-Magazin, das sowohl in den USA als auch in Europa eine wichtige Rolle im Hipster-Milieu spielt. »Ich bin glücklich darüber, weiß zu sein. Ich denke, das ist etwas, worauf man stolz sein kann«, so Vice-Redakteur Gavin McInnes, und weiter: »Ich will nicht, dass unsere Kultur verwässert wird. Wir müssen die Grenzen dichtmachen und dafür sorgen, dass sich alle an den westlichen Lebensstil der Englisch sprechenden Weißen assimilieren.«
Von solchen mehr oder weniger »ironisch« oder provokativ zur Schau getragenen Ansichten ist es nicht mehr weit zur Vereinnahmung des Hipstertums durch die Rechten – so geschehen in Deutschland, wo Nazis und Hipster sich jüngst zu »Nipstern« kreuzten. 2014 gelang dem Journalisten Jesko Wrede bei einer Demonstration von Neonazis in Magdeburg ein Schnappschuss: Nazis mit Ray-Ban- Brillen, Vollbärten und Jutebeuteln. Das Phänomen wurde dann von mehreren Tageszeitungen aufgegriffen. Das Magazin Rolling Stone widmete den deutschen »Nipstern« in seiner internationalen Ausgabe sogar eine mehrseitige Reportage. »Nipster« präsentieren sich etwa im Tumblr- Blog KindStattGroß, der Rechtsradikalismus mit Versatzstücken der alternativen Popkultur in Verbindung bringt. So finden sich zwischen Video-Verlinkungen zu Bands wie Zugezogen Maskulin und Fotos, die aus Vice stammen könnten – wären da nicht Tätowierungen wie »Stolz und Ehre« oder T-Shirts mit SS-Totenkopf oder der Aufschrift »Better Dead Than Red« –, Empfehlungen wie: »Lest Rosenberg!«
Das Phänomen – mitunter auch als Internetphänomen und bloßer Medienhype kritisiert – zeigt wohl vor allem die alte Strategie der Rechten, Stile und Symbole diverser Jugendsubkulturen zu kopieren. Man kann es aber auch als einen Beleg für die Anschlussfähigkeit des Hipstertums an bürgerliche und rechte Ideologien verstehen. Schon im Selbstverständnis von Vice zeigt sich sein offener Widerspruch: Das Zielpublikum der Zeitschrift sind laut eigener Aussage »kritische, trendbesessene und kulturbestimmte Großstadtbewohner, zwischen 21 und 40 Jahren«. Man will also noch irgendwie »kritisch« sein. Gleichzeitig hechelt man aber jedem Trend hinterher und orientiert sich an traditionellen Werten. Kein Wunder, dass die deutsche Ausgabe des Vice-Magazins Anfang des Jahres eine »Renaissance der Spießigkeit« konstatierte: Was früher mal eine Beleidigung war, sei heute ein Eingeständnis. »Warst du mal in Neukölln ein Bier trinken? Und hast du dich mal gefragt, warum dort jede Kneipe wie Omas Wohnzimmer aussieht? Frag dich doch auch mal, warum wir uns in diesem Nachkriegs-Ambiente so wohl fühlen«, so das Magazin, das auch die Ursache der neuen Spießigkeit kennt: die Sehnsucht nach sozialer Sicherheit in einer zunehmend unsicherer werdenden Welt. Das Marktforschungsinstitut Rheingold spricht in einer Studie gar von der »Generation Biedermeier«. Die Gründe: »Das lange Zeit sichere und berechenbare Versorgungs-Paradies Deutschland hat furchterregende Risse bekommen.« Deshalb sei das Lebensgefühl der Jugend nicht mehr wie in den 1970er-Jahren von einer Revolte gegen die gesellschaftlichen Verhältnisse geprägt, sondern von einer schwelenden Absturz-Panik. Zwar erzeuge das bei den Jugendlichen zunächst eine »verzweifelte Wut auf die Verhältnisse«, diese werde jedoch oft nicht direkt ausgelebt. Vielmehr werde ihr mit Anpassung und Selbstdisziplinierung begegnet – mit Eigenschaften also, die vor dem stets drohenden sozialen Abstieg schützen sollen. Ihre Ängste versuchten die Jugendlichen, so das Kölner Institut, auch zu bannen, indem sie sich strikt von Menschen abgrenzen, die bereits abgestürzt sind. »Den Opfern und Verlierern der Gesellschaft wird nicht Mitleid oder Solidarität entgegengebracht, sondern Verachtung und Schmähung. Häufig selbst von Jugendlichen, die sich selbst als eher links oder als solidarisch charakterisieren«. So trat vor drei Jahren eine »Hipster- Antifa Neukölln«, angefeuert von den Mainstreammedien, mit Slogans wie »Für die Aufwertung der Kieze – für mehr Bars, Soja-Latte, Wi-Fi und Bio-Märkte!« für eine Radikalisierung der Gentrifizierung ein und verglich die Vertreibung der Armen aus den Szene-Vierteln mit der Befreiung von der NS-Herrschaft am 8. Mai 1945.
Nicht zuletzt deshalb beschreibt der Jugendkulturforscher Philipp Ikrath den Hipster als den Idealtypus der herrschenden Gesellschaftsordnung: »Der Neoliberalismus behauptet, dass es in einer ›Wissensgesellschaft‹ nicht um alte Macht und altes Geld geht, sondern dass derjenige mit den besten Ideen, der Individualist, der unkonventionelle Denker die Nase vorn hat. Wer risikofreudig ist und sich auf die eigene Intuition verlässt, hat fast schon gewonnen. Die Leitfigur dieses Zeitalters ist nicht mehr der gütige Patriarch, der Wirtschaftskapitän oder der als eine Nummer unter vielen im Großunternehmen wirkende Yuppie-Banker, es ist der Startup-Unternehmer. Der kulturelle Eklektizismus des Hipsters, sein mitunter bohemienhaftes Auftreten ist also, in dem Licht betrachtet, kein Statement gegen den Zeitgeist, ganz im Gegenteil.« Kurz gesagt verkörpere der Hipster geradezu viele der Facetten des neoliberalen Zeitgeistes unserer Gesellschaft – als deren Opfer genauso wie als deren Motor. »Er ist in einer anderen Epoche als der unsrigen tatsächlich nicht vorstellbar.«
Da ist es nur konsequent, dass er derzeit dabei ist, die letzten Insignien der Rebellion abzulegen und sich in der bürgerlichen Mitte aufzulösen. »Der Hipster ist tot – und das, was danach kommt, wird euch möglicherweise nicht gefallen!«, so David Infante, Autor des Szene-Portals Mashable aus Williamsburg, der Wiege der Hipster-Bewegung. Infante argumentiert, er und seine Generation hätten sich weiterentwickelt: Er sei jetzt ein »Yuccie« – für »Young Urban Creative«, eine Abwandlung des Begriffs Yuppie (»Young Urban Professional«) aus den 80er-Jahren. »Wer in einer Metropole wie New York oder San Francisco lebt, kennt wahrscheinlich viele von ihnen«, schreibt Infante. »Als Social- Media-Berater koordinieren sie Instagram- Kampagnen, sie programmieren ein Tinder für Hunde oder gründen ein Onlinegeschäft, in dem sie Sonnenbrillen aus nachhaltig geerntetem Bambus feilbieten!« Der Hipster will Sicherheit, und dazu muss er Geld verdienen: Schnell reich zu werden und trotzdem seine Unabhängigkeit zu bewahren, das sei so etwas wie »der große Yuccie-Traum«.
Den kompletten Artikel lesen Sie in der Melodie und Rhythmus 6/2015, erhältlich ab dem 30. Oktober 2015 am Kiosk, im Bahnhofsbuchhandel oder im Abonnement. Die Ausgabe können Sie auch im M&R-Shop bestellen.
Anzeigen


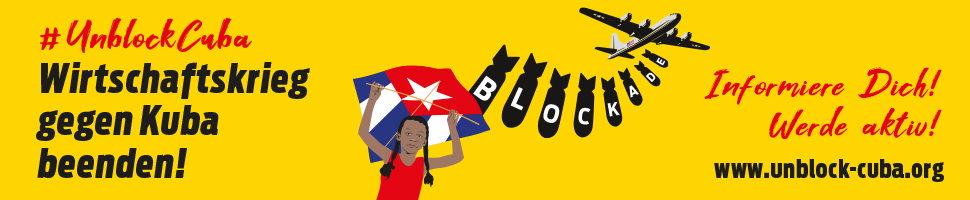

 Fotos von Katja Koschmieder und Jens Schulze
Fotos von Katja Koschmieder und Jens Schulze








