
Peter Maffay in Afghanistan
Foto: Tine Acke
Afghanistan 13 Jahre danach: Mit den abziehenden Besatzungstruppen entfällt auch deren popmusikalische Betreuung. Eine Bilanz zur Verantwortung der Kunst in Kriegszeiten
Essay: Gerd Schumann
Über 13 Brücken musst Du gehn, 13 dunkle Jahre überstehn, hätte Peter Maffay singen sollen, damals, 2005 in Afghanistan. Wusste es nicht besser, tat es also nicht, blieb bei sieben, der ewige Oldie mit den Oberarmen aus der Muckibude, einer der ersten deutsch singenden Truppenbetreuer nach 1945. Heute gibt er sich einsichtig. Konzepte »militärischer Natur« seien untauglich, das hätten »wir alle« inzwischen gemerkt, »selbst die, die es nicht wahrhaben wollten«. Sagt er – und sagt nicht: Auch ich wollte es nicht wahrhaben. Und fragt nicht nach seiner Verantwortung.
Die oft beschworene Verantwortung der Kunst hat versagt, wenn der Krieg ausbricht. Eine im zivilen Vorfeld gewachsene Geschichtsvergessenheit, befördert durch Schweigen und Verdrängen, entfaltet dann im Feld scheinbar unaufhaltsam ihre militärische Tauglichkeit und reproduziert permanent ihre eigenen Lügen von »Sicherheit schaffen«, »Aufbauhilfe leisten« und »unsere Freiheit verteidigen«. 13 Jahre Afghanistan werden demnächst bei anderen »Auslandseinsätzen« ausgewertet: Vom Hindukusch, so heißt es, ziehen die NATO-Truppen zum Jahresende ab, darunter die deutschen. Von deren Boden sollte, so der historische Eid, nie wieder ein Krieg ausgehen.
Manchmal erhielten die Soldaten draußen in ihren festungsartigen Lagern Überraschungsbesuch, nicht nur von Politikern. Im Laufe der Zeit zog ein – zahlenmäßig recht kleiner und künstlerisch ziemlich bescheidener – Haufen von Artisten verschiedener Genres an die Front und spielte auf. Für ein paar Stunden verbreitete er Freude und Spaß, brachte manchen Legionär zum Lachen und dessen Herz zum Hüpfen. Bombige Stimmung herrschte, als Bülent Ceylan, Kurt Krömer, Wigald Boning, Matze Knop ihre Witze am laufenden Band rissen. Das vertrieb Langeweile und trübe Gedanken und machte zudem fit für den uniformen Alltag, einsam und allein und ungeliebt in feindlicher Umgebung.
»Unterhaltung ist ein wesentlicher Faktor für die Motivation«, sagt Alexander Kleiszmantatis von der »Spaßkompanie« (Der Spiegel), die Bundeswehrkontingente in aller Welt betreut – in Mali und Zentralafrika, am Horn von Afrika, in vormals jugoslawischen Gegenden, an der Grenze zu Syrien und im Mittleren Osten. Auch für ihn heißt es: Hindukusch adé – vergelt`s Gott, Ihr aufopferungsvollen Entertainer, die Ihr allesamt Euer Bestes gegeben habt. Coverbands von den Puhdys bis AC/DC beispielsweise; Michael Wurst, der in der Sat.1-Sendung »Star Search« immerhin Platz drei belegte; oder Die Wiesenfelder aus Franken (»Heftich fränggisch«), die sonst in Bierzelten schunkelnde Massen in die Ekstase treiben. Sängerin Ramona berichtet: »Wir haben jetzt einen kleinen Weinfest-Marathon hinter uns, zwei Hammer-Auftritte mit viel Wein, Weib und vor allem Gesang.« Ein Prosit der Gemütlichkeit, ob kornblumenblau oder olivgrün.
Neben Peter Maffay kamen andere namhafte Popstars im Bundeswehr-Airbus angeflogen. Die meisten stammten aus der Millenium- Wendezeit, kämpften nun um ihr Überleben auf der Showbühne, brauchten also Publicity. Der Auftritt vor Militärs barg jedoch Unwägbarkeiten in sich: Was würden die Fans davon halten? Von wegen: »Dieser Weg wird steinig und schwer« – der Song hatte schließlich mit Toreschießen zu tun, und nicht mit Menschenerschießen. Jedenfalls konnte es schon verwirrend wirken, wenn sich Xavier Naidoo, der bei jeder Gelegenheit den nächstenliebenden Christen heraushängen lässt, plötzlich als predigender Gotteskrieger im Camp Marmal betätigt. »Schön, dass Ihr da seid«, rief er – wie sonst im Frieden eben auch – den biertrinkenden Kämpfern zu und informierte sie darüber, dass es »in Deutschland mehr Menschen (gibt), die schätzen, was Ihr hier tut«. Die Lüge als Psycho-Doping, Naidoo als Propagandist. Schließlich bewiesen die hohen Ablehnungsquoten des »Einsatzes« bei Umfragen allzeit Konstanz.
Wie sich Sarah Connor vor der Truppe geäußert hat, ist nicht überliefert. Ihr größter Auftritt liegt ein knappes Jahrzehnt zurück. Es machte sie sympathisch, als sie im Juni 2005 in der Münchner Allianz-Arena vor dem Fußballspiel Bayern – Deutschland spontan die Nationalhymne umdichtete: »Brüh im Glanze dieses Glückes«, wünschte sie dem »deutschen Vaterland«. Dieses dann am Hindukusch verteidigen zu helfen, entschloss sie sich erst fünf Jahre danach, als sie sich der Künstlerleitstelle der Bundeswehr anbot, als »Volunteer for Germany« (frei nach Jefferson Airplane – so ändern sich die Zeiten) zu arbeiten, was das »Bundesverteidigungsministerium«, das immer noch so heißt, »freudig überraschte«. Also lobte dessen Sprecher die in einem Karrieretief verschwundene Künstlerin zurück: Dass »eine internationale Sängerin von diesem Format die Soldaten besuchen will, zeugt von Wertschätzung«.
Wie besonders auch die Auftritte, die Paul Kalkbrenner (»Berlin Calling«) voller Inbrunst zur Hebung des soldatischen Selbstwertgefühls hinlegte – nachsehbar auf YouTube. »Exciting« sei das alles gewesen, meinte der Komponist moderner deutscher Marschmusik und Plattenaufleger in »Locations« around the world. Aufregend, wenn »Sky and Sand« zu »Preußens Gloria« von heute mutiert, links, zwo, drei im Techno-Schritt. Kunst hat auch mit dem Kopf des Künstlers und dessen Inhalt zu tun. »Damit alles mit rechten Dingen zugeht, stehen auch Militärpolizisten vor der Tür«, wird Kalkbrenner informiert. Den 1977 in Leipzig Geborenen trieb es im Kriegswinter 2010/2011 nach Afghanistan, wo er in zwei Feldlagern einheizte: Masar-e Sharif und Kunduz.
Elektronische Tanzmusik in Kunduz also, ein gutes Jahr nach dem großen Schlachten ebendort durch einen Luftangriff, den der kommandierende Oberst Georg Klein veranlasst hatte: Über 140 Afghanen, viele Frauen und Kinder darunter, starben am 4. September 2009 bei der Bombardierung eines Tanklasters. Klein, ein mausgrauer Befehlshaber, der wie die personifizierte Banalität des Bösen wirkt, verantwortet das größte Massaker während des Afghanistan-Krieges. Der Oberst wurde – zurück am Schreibtisch in Deutschland – zum Brigadegeneral befördert.
Til Schweiger mied Kunduz, kam aber nach Masar-e Scharif. Sein schrecklichstes Erlebnis dort – neben der ewigen Hitze – beschreibt er im Bild-Kriegstagebuch: »Am Tag unserer Abreise wird ein amerikanischer Soldat sterben – beim Joggen. Er wird nachts von einem Panzer überrollt.« Da leidet Schweiger. »Einer Familie, irgendwo in Amerika, wird jetzt für immer das Herz gebrochen – wegen so einem scheiß Unfall.« Scheiß Unfall beim Joggen. Schweiger, der bekannt dafür ist, die Worte aus fast geschlossenem Mund herauszupressen und also zu zerquetschen, ließ sich von den deutschen Staatsbürgern in Uniform auf afghanischem Boden feiern, gab dem Soldatensender Andernach (»Guten Morgen, Afghanistan« heißt deren Frühstückssendung, frei nach Robin Williams) ein patriotisches Interview.
Er steht als Typ für das Martialische und kommt derzeit authentisch rüber als »Tatort«-Kommissar anderen Typs: Schweiger spielt Nick Tschiller, spielt Rambo, spielt sich selbst, die Landser-Generation des TV-Krimis, passend zu den neuen Kriegen. Sein Auftritt hier wie dort propagiert ein waffenfetischistisches Macho-Selbstjustiz-Gehabe. Dafür erhält er von vielen Seiten Annerkennung, wird von Leander Haußmann und Jan Josef Liefers in übereinstimmend gedankenloser Oberflächlichkeit gewürdigt. Der »versucht im Tatort etwas. Meine Fresse«, bewundert ihn Haußmann. »Er ist der Filmemacher, der am sichersten mit seinen Filmen den Mainstream auf die Zwölf trifft«, lobt Liefers. Der Sänger und Schauspieler traf bereits 2013 »auf die Zwölf«, als er im syrischen Aleppo nach westlichem Militär verlangte.
Kultur als Unkultur der Gewalt, die die Lebensweise und damit den Alltag verändert. Der nassforsche, vernunftresistente Schweiger als Idol. Die Dummheit wird zur materiellen Kraft – in Deutschland und Europa wie auf den Schauplätzen deutschen »Engagements«. Dessen Intensität soll wachsen, verlangen Außenminister und Präsident. Die zuständige Ministerin, eine Blondine mit Drei-Wetter-Taft-Sturmfrisur, ließ sich jüngst mit Bomberjacke ablichten, Modell George W. Bush. Der verhasste US-Präsident hatte es im Irak-Krieg vorgemacht. Redneck Bush wurde nach und nach zum Feind im eigenen Land.
Wer konnte ahnen, dass als Reflex auf diese Figur dann völlig grundlos seinem Nachfolger der Friedensnobelpreis hinterhergeschmissen werden würde? Wie danach auch Frau Merkels EU. Die sich nun bedankt und deutsche Mordwaffen in alle Welt exportieren lässt, in die Diktaturen am Golf, die Ausrüster und Langzeit-Sponsoren der Jihadisten, Kopfabhacker und Steiniger. Derweil Joachim Gauck, der Herr Pastor, von Polen aus Russland droht. »Schwerter zu Pflugscharen« war gestern, als östliche Bewaffnung dem Imperialismus Zurückhaltung auferlegte und im Westen Lieder gegen Atomraketen entstanden. Wo sind die Songs und deren Sänger im Zeitalter der Killer-Drohnen? Geht es um die Kriege der Gegenwart, die sich allesamt außerhalb des bisher geläufigen Völkerrechts abspielen, herrscht ein gespenstisches, unüberhörbares Schweigen. Fast scheint es, als sei der unverzichtbare Anspruch der Kunst, sich einzumischen und sich querzulegen wo nötig, verkümmert oder gar ad acta gelegt. Der aufrechte, aber einsame Gang Peter Handkes im Jugoslawien-Krieg blieb einzigartig. Die Verleumdungswelle, die den Schriftsteller umspülte, auch. Krieg zu führen, ist einfach geworden. Ihn zu verhindern, schwer.
Über allen Wipfeln ist Ruh, kaum ein Hauch von Widerstand spürbar und mit ihm die besondere »Ästhetik des Widerstands«, wie Peter Weiss seine 1981 fertiggestellte Roman- Trilogie nannte. Eine der Thesen darin: Solange der Wille zu Gegenwehr vorhanden ist, ist auch Kultur vorhanden. In Schweigen, in Anpassung schwindet die Kultur …
Jene westliche Kultur, ausgestattet mit Speed, Alk und der Bibel im Tornister, die Musik aus der Heimat aus den Ohrstöpseln unterm Gefechtshelm, hat Weiss nicht gemeint. Die hinterlässt in Afghanistan dauerhaft bleibenden Eindruck.
Den Artikel lesen Sie in der M&R 6/2014, erhältlich ab dem 31. Oktober 2014 am Kiosk, im Bahnhofsbuchhandel oder im Abonnement. Die Ausgabe können Sie auch im M&R-Shop bestellen.
Ähnliche Artikel:



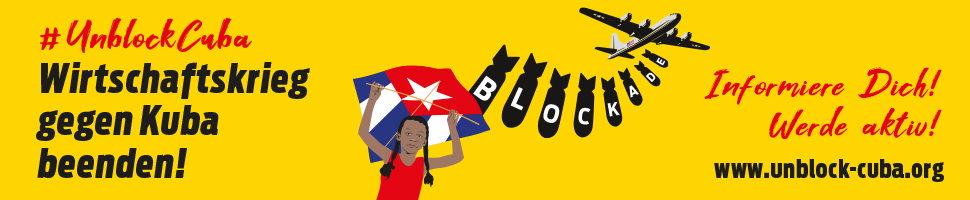

 Fotos von Katja Koschmieder und Jens Schulze
Fotos von Katja Koschmieder und Jens Schulze








