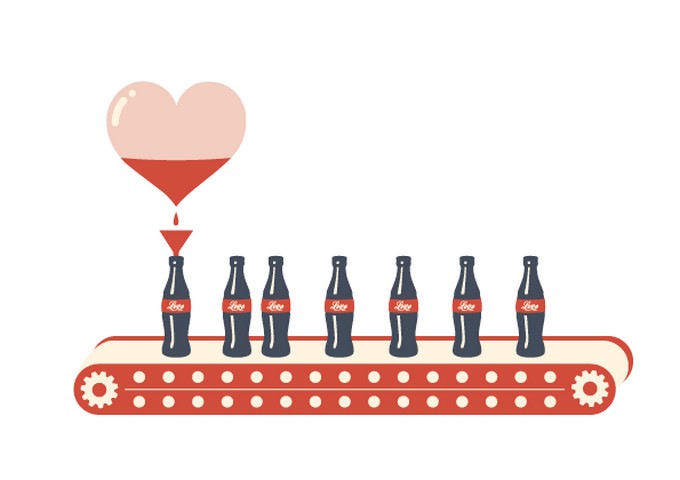
Illustration: Daniel Hager
Die Kulturindustrie benutzt sie als Label für die profitable Vermarktung von Ramsch und falschen Gefühlen. Rechte versuchen, in ihrem Namen alles an den Mann zu bringen, was genau das Gegenteil von ihr ist. Alle Erscheinungsformen der Instrumentalisierung der Liebe in unserer zunehmend von Entfremdung geprägten Gesellschaft erweisen sich letztlich als Auswüchse der Bemühungen des Kapitalismus, sie zu seinem Synonym für sich selbst und zum Reklamewort für seine Zumutungen zu deformieren. Nicht zufällig heißt der Werbeslogan für ein nicht nur unter Gewerkschaftern, Tier- und Umweltschützern völlig zu Recht verhasstes Fastfoodunternehmen: »Ich liebe es.«
Die Liebe gilt als der größte Grundkonsens der Menschheit, sie zu erfahren, ist unsere tiefste Sehnsucht – alle sind irgendwie »verliebt in die Liebe«, wie es in einem Schlager aus den 70erJahren heißt. Kein Wunder. Wahre Liebe ist nicht nur der Balsam auf unseren von Atomisierung und Einsamkeit entzündeten Seelen. Ihr Wesenskern birgt ein antiherrschaftliches Moment, wie wir es bei der Rezeption gelungener Kunst erleben: Die Geste des Sichanvertrauens und -anschmiegens, mit der wir einem geliebten Menschen begegnen, ist dem Vorrang verwandt, dem wir dem Kunstobjekt gewähren – der leidenschaftlichen Hingabe, mit der wir uns ihm sinnlich und intellektuell überantworten. In dieser Umkehrung der alle Belange unseres Lebens in der kapitalistischen Gesellschaft bestimmenden Subjekt-Objekt-Beziehung drückt sich der Widerstand des unfreien Menschen gegen falsche Besitzverhältnisse aus – in der patriarchal geprägten Familie wie auf dem Lohnarbeitsmarkt.
»Die Liebe gibt sich, sie kann sich nicht verkaufen« – dieses Diktum von Wilhelm Liebknecht unterstreicht die auf den revolutionären Humanismus von Alexandra Kollontai, Rosa Luxemburg und anderen marxistischen Theoretikern gestützte These des US-amerikanischen Philosophen Richard Gilman-Opalsky, Liebe sei eine »kommunistische Macht« gegen das Warentauschprinzip, die wir in dieser Ausgabe ausgiebig erörtern werden. Als Träger des emanzipativen Potenzials, Individuen zu einer heterogenen Kollektivität zu vereinen, die vitale Interessen hat, die über die der einzelnen Mitglieder hinausgehen, bildet die Liebe die Keimform von Solidarität. Nicht zuletzt deshalb sei sie als »Waffe« auf dem »Schlachtfeld« des ideologischen »Stellungskriegs« der antikapitalistischen Linken in Anschlag zu bringen, wie Gilman-Opalsky in Anlehnung an Gramsci sagt. Wir brauchen sie in unserem Kampf für eine Welt, in der alle Menschen Genossen sein werden – auch als Treibstoff für unseren Hass auf das Kapital, das weder Mitgefühl noch Zärtlichkeit kennt. Sie darf nicht den »Bachelors«, Sektengurus, »Elite-Partner«-Vermittlern und anderen Zuhältern überlassen werden, die sich mit ihren Kuppel- und Fummelshows, Love Bombings und »Parshippings« als Komplizen jenes schlimmsten aller Liebestöter erweisen.
Liebe Leser, als unverdinglichte Erfahrung muss die Liebe aber einfach nur sein dürfen, was sie ist. In unserer krisengeschüttelten Gegenwart ist sie vor allem das blutende »Herz der herzlosen Zeit« – um es mit den Worten von Erich Fried, einem der bedeutendsten Liebespoeten, zu sagen. Wir müssen gewaltig aufpassen, dass es nicht aufhört zu schlagen …
Susann Witt-Stahl
Chefredakteurin M&R
Der Beitrag erscheint in der Melodie & Rhythmus 4/2021, erhältlich ab dem 17. September 2021 am Kiosk, im Bahnhofsbuchhandel oder im Abonnement. Die Ausgabe können Sie auch im M&R-Shop bestellen.
Anzeigen




 Fotos von Katja Koschmieder und Jens Schulze
Fotos von Katja Koschmieder und Jens Schulze








