
Klezmorim aus Rohatyn, 1912
Foto: wikimedia.org / public domain
Klezmer als Objekt von Ressentiment und Fetischisierung
Moshe Zuckermann
Bei Freud gibt es den Begriff des Unheimlichen: Etwas, das aus gutem psychischen Grund verdrängt worden ist, mithin im eigenen Unbewussten (also im »Heimischen«) erhalten geblieben ist, kehrt zum Bewusstsein als etwas Fremdes und doch entfernt Bekanntes wieder (was sein »Unheimliches« ausmacht). Die Klezmer-Musik darf als das Unheimliche der jüdischen aschkenasischen Kultur gelten, und zwar sowohl in Israel als auch in Deutschland.
In Deutschland ist Klezmer außerordentlich beliebt. Er genießt geradezu Kultstatus. Zuweilen will es scheinen, als begriffe man seine Wertschätzung und Pflege als eine Art kultureller »Wiedergutmachung« der Deutschen am jüdischen Volk. Merkwürdig ist daran, dass Klezmer in Israel ganz anders kodiert ist, daher auch einen gänzlich anderen kulturellen Stellenwert einnimmt. Den allermeisten Israelis gilt Klezmer (»klezmer« ist der jiddisch mutierte Ausdruck für das hebräische »kli semer« bzw. »klej semer« im Plural, Oberbegriff für »Musikinstrumente«) als Musik des alten osteuropäischen Schtetl-Judentums, vergleichbar etwa mit kulturellen Erzeugnissen vormoderner Dorf- oder Straßenmusikanten. Das war sie auch, und deshalb avancierte sie gerade in Israel zum Gegenstand eines anhaltenden latenten Ressentiments. Denn insofern sie für das Diaspora-Judentum stand, manifestierte sich unter anderem in ihr eben das, was der moderne politische Zionismus bzw. die von ihm geschaffene und propagierte neuhebräische Kultur zu überwinden trachtete. Seine Ideologie des »Neuen Juden« ging mit einem neuen Sprach- und Kulturverständnis einher, das in seiner Unerbittlichkeit der Absetzung und Loslösung von allem, was für diasporisch erachtet wurde, kaum zu überbieten war. Nirgends war der Habitus osteuropäischer Lebenswelten verpönter als unter den gesinnungsgestählten Sachwaltern des zionistischen »Muskeljuden«, die sich der Negation der Diaspora als Matrix ihres Selbstverständnisses verschrieben hatten. Und nirgends wurde eben auch die Kultur jener Lebenswelten abschätziger behandelt als unter den Protagonisten der zionistischen Kulturrenaissance. Klezmer gehörte – unausge sprochen, aber auch unübersehbar – dazu. Nachdem er ab Ende der 1960er-Jahre, im inzwischen gegründeten Israel, »wiederentdeckt« wurde, erfreute er sich neuer »Legitimität«, aber eher als ein Exotikum, das sich vor allem im nicht- bzw. antizionistischen orthodoxen Judentum und in gewandelter Form auch bei nationalreligiösen Juden erhielt. Den allermeisten Israelis gilt Klezmer als »dazugehörend«, mutet er aber auch fremd an.
Die Beliebtheit von Klezmer in Deutschland verströmt zwar einen innocenten Charme, verweist zugleich aber auch auf eine spezifisch deutsche Neuralgie. Denn wenn Klezmer die Musik des diasporischen Judentums Osteuropas, einer nunmehr untergegangenen Welt, gewesen ist, dann hat der Zionismus, symbolisch betrachtet, den »Vatermord« an ihr verübt, aber den realen Mord, die wirkliche historische Vernichtung dieser Welt, haben Deutsche begangen. Der Nazismus vollstreckte in barbarischer Unerbittlichkeit den physischen Untergang der jiddischen Lebenswelt und ihrer Kultur. Es ist nicht auszuschließen, dass die außergewöhnliche Beliebtheit dieses Kulturguts unter den Nachkommen der Generation, die seine Träger und somit das Kulturgut selbst vernichtet hat, eine unbewusste Bitte um Vergebung, eben den Willen zur »Wiedergutmachung«, zum Inhalt hat. Dass nichts mehr »wiedergutgemacht« werden kann, dürfte jedem klar sein, der sich das Ausmaß der Katastrophe und ihrer Auswirkungen vor Augen führt. Gleichwohl ist das Bedürfnis der »Wiedergutmachung« zunächst als honorig zu werten. Zum Problem gerät es dort, wo dieses Bedürfnis in Philosemitismus umschlägt und Klezmer – gleichsam als das Unheimliche eines wiedergekehrten Verdrängten – zum Fetisch verkommt. Denn Philosemitismus und Antisemitismus wurzeln beide im selben Ressentiment; beide abstrahieren den Juden, blenden sein konkretes Dasein aus, um auf ihn Fremdbestimmtes zu projizieren. Der Jude als Projektionsfläche also – und die »Bewunderung« für ihn nur ein Fetisch, der etwas mit den Bedürfnissen des Proijzierenden, so gut wie gar nichts aber mit dem real existierenden Juden zu tun hat.
Den Artikel lesen Sie in der Melodie und Rhythmus 5/2016, erhältlich ab dem 2. September 2016 am Kiosk, im Bahnhofsbuchhandel oder im Abonnement. Die Ausgabe können Sie auch im M&R-Shop bestellen.
Ähnliche Artikel:




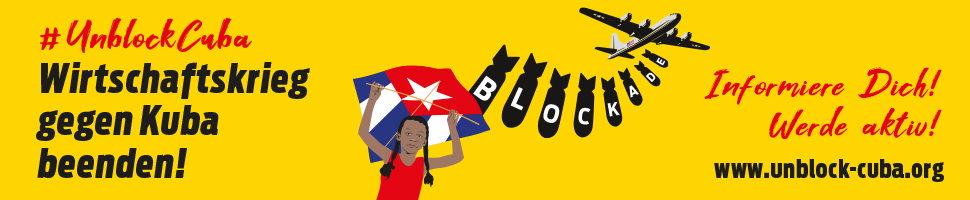

 Fotos von Katja Koschmieder und Jens Schulze
Fotos von Katja Koschmieder und Jens Schulze








