
Gerardo Alfonso im M&R-Interview
Fotos: Dietmar Koschmieder
Gerardo Alfonso über Musik jenseits von Buena Vista, die Schwierigkeiten innerhalb der revolutionären Entwicklung Kubas und die Öffnung zum US-Markt
Interview: Denis Gabriel & Gloria Fernandez
Gerardo Alfonso, Jahrgang 1958, gehört zur Bewegung der Nueva Trova Cubana (Neues kubanisches Lied). Die Nachfolger der großen Trovadores Kubas wie Carlos Puebla orientierten sich früh an den »Cantautores« (singende Autoren) genannten Liedermachern der »ersten Generation« wie – vor allem – Silvio Rodríguez und Pablo Milanés. Alfonso ließ sich zudem besonders inspirieren von der ländlichen Campesino-Musik ebenso wie von afrokubanischen Rhythmen und den Klängen der Karibik und Brasiliens. Auch nordamerikanische Entwicklungen in Jazz und Rock sog er auf.
 Mit »Sábanas blancas«, den »weißen Bettlaken«, trocknend auf Balkonen im Atlantikwind, schuf der in Havanna Geborene Anfang der 1990er-Jahre einen Song, der zur Hymne auf das hektische, turbulente und nicht immer einfache Leben in Kubas Hauptstadt wurde. 1997 erschien sein Lied auf die Ideale Ernesto Che Guevaras: »Son los sueños todavia« (Es sind immer noch die Träume) wurde zu einer Art musikalischem Monument der globalen antiimperialistischen Jugendbewegungen. Alfonso galt immer auch als kritischer Geist, der sich besonders mit den Widersprüchen, mit Mängeln und Fehlentwicklungen der kubanischen Revolution auseinandersetzte.
Mit »Sábanas blancas«, den »weißen Bettlaken«, trocknend auf Balkonen im Atlantikwind, schuf der in Havanna Geborene Anfang der 1990er-Jahre einen Song, der zur Hymne auf das hektische, turbulente und nicht immer einfache Leben in Kubas Hauptstadt wurde. 1997 erschien sein Lied auf die Ideale Ernesto Che Guevaras: »Son los sueños todavia« (Es sind immer noch die Träume) wurde zu einer Art musikalischem Monument der globalen antiimperialistischen Jugendbewegungen. Alfonso galt immer auch als kritischer Geist, der sich besonders mit den Widersprüchen, mit Mängeln und Fehlentwicklungen der kubanischen Revolution auseinandersetzte.
Seine bisher 15 CD-Produktionen reichen vom Solo mit akustischer Gitarre über Lieder mit eigener Band bis zur großen Performance mit dem Symphonieorchester von Camagüey, mit dem er 2010 sein Werk »Leyendas camagüeyanas« einspielte. Er produzierte in Italien und Deutschland, wo in Zusammenarbeit mit »Cuba Sí« zwei Platten entstanden. Demnächst erscheint – übrigens mit Unterstützung der UNESCO, weil er auf Kuba selbst zunächst kein Label fand – die Produktion »La ruta del esclavo« (Der Weg des Sklaven): Geschichten, die 130 Jahre nach der Befreiung von der Sklaverei auch von seiner eigenen Herkunft und Biografie erzählen. Wir sprachen Gerardo Alfonso, der im Juli mit M&R und »Cuba Sí« auf Deutschland-Tour ist, in Havanna.
Seit 1996, dem Jahr seines großen Revivals mit Hilfe von Ry Cooder und Wim Wenders, gilt der Buena Vista Social Club (BVSC) als eine Art Markenzeichen Kubas. Doch die übrigen Musiken der Spitzenklasse und deren exzellente Interpreten und Komponisten blieben eher im Schatten. Wie wirkt sich das bis heute aus?
 Positiv und negativ. Einerseits widerspiegelt das Projekt Buena Vista keineswegs die musikalische Breite und Vielfalt aus den über 50 Jahren Entwicklung seit der kubanischen Revolution – insofern förderte das kapitalistische Geschäft mit dieser Musik nur eine einzige, bestimmte Tendenz. Andererseits erfuhren die wunderbaren, im BVSC vorgestellten Musiker in der Abenddämmerung ihrer Karriere noch einmal großes internationales Ansehen. Sie traten auf die Bühnen und genossen es. Und: Es zog eine Musik in die internationale Arena ein, die bis dato nicht sehr bekannt war, die aber äußerst tiefgründige Wurzeln hat. Das wiederum war sehr gut für die kubanische Musik insgesamt.
Positiv und negativ. Einerseits widerspiegelt das Projekt Buena Vista keineswegs die musikalische Breite und Vielfalt aus den über 50 Jahren Entwicklung seit der kubanischen Revolution – insofern förderte das kapitalistische Geschäft mit dieser Musik nur eine einzige, bestimmte Tendenz. Andererseits erfuhren die wunderbaren, im BVSC vorgestellten Musiker in der Abenddämmerung ihrer Karriere noch einmal großes internationales Ansehen. Sie traten auf die Bühnen und genossen es. Und: Es zog eine Musik in die internationale Arena ein, die bis dato nicht sehr bekannt war, die aber äußerst tiefgründige Wurzeln hat. Das wiederum war sehr gut für die kubanische Musik insgesamt.
 Aber lässt der BVSC nicht zu wenig Raum für anderes – schließlich steht er bis heute für kubanische Musik insgesamt?
Aber lässt der BVSC nicht zu wenig Raum für anderes – schließlich steht er bis heute für kubanische Musik insgesamt?
Das Interesse an der traditionellen Musik des Clubs brachte Bewegung in das Verhältnis zwischen den verschiedenen Stilen. Zuvor – ich spreche von den Jahren 1992 bis 1996 – herrschte ein Übergewicht zugunsten der Timba-Bands, des Salsa, der entsprechenden Orchester. Diese waren überrepräsentiert. Durch das Phänomen BVSC entstanden neue Nuancen innerhalb der Farben und der Melodien im Genre der volkstümlichen kubanischen Musik, aber auch des Jazz, der Nueva Trova oder in der klassischen Musik.
Sie sprechen die »Sonderperiode« ab Anfang der 1990er an, als es an vielem mangelte …
Es war eine schwierige Zeit. Wir befanden uns in einer starken wirtschaftlichen und sozialen Krise. Man ging nicht davon aus, dass bestimmte Widersprüche zwischen den Einrichtungen und den Menschen vorhanden sind, und musste nun akzeptieren, dass es differierende Denkweisen gab. Aber so ist das Leben halt. Es gibt Krisen, es gibt Reibungen.
Sie haben damals mehrere CDs eingespielt.
Einige Aufnahmen erschienen nicht, obwohl sie bereits produziert waren. Zum Beispiel spielte ich die CDs »Sábanas blancas« und »Los lobos se reúnen« (Die Wölfe versammeln sich) ein. Erst 1995 wurde eine Platte mit dem Titel »Sábanas blancas« herausgegeben, auf der sich dann auch »Los lobos se reúnen« befand.
Und warum nicht unter dem Titel »Los lobos se reúnen«?
Ich nehme an, weil das ein kritischer Rap war. Anstatt dass das Label zu mir sagte: »Wir sind nicht mit diesem Lied einverstanden«, wurde die Veröffentlichung immer wieder verzögert. Es gab allerdings eine Kassette. Ich bat dann um eine Lizenz bei dem Label Bis Music. Schließlich kam die Aufnahme auf »Sábanas blancas« heraus.
Hatte sich etwas an der Situation verändert, als das Album 1995 erschien?
Nein. Es gab aber ein anderes Feedback, und ich hatte noch zwei zusätzliche Titel mit eingebracht. Der Text war geblieben, wie er war. Einige Produktionen kamen damals nicht auf den Markt. Es lag wahrscheinlich auch an der Situation des Mangels. Ich meine, der hat sich ja relativiert mit der Zeit.
Seit Ihrer Arbeit mit dem Symphonieorchester Camagüey 2010 ist keine CD von Ihnen mehr erschienen. Warum?
Ich weiß es nicht. Es existiert ein staatlicher Etat für die Produktion von CDs. Viele junge Liedermacher hatten bis dato keine Aufnahmen, und ich gehe davon aus, dass Prioritäten gesetzt wurden, meine aber, dass das nicht gerecht ist. Die Kontinuität ist nicht gewahrt, man ist abhängig von den Labels.
Könnten Sie nicht ihre CDs selbst produzieren?
Wenn mir die Bedingungen dafür zur Verfügung stünden – vom vorliegenden Material her wäre das ohne Weiteres möglich. Eine Menge Lieder warten darauf, herausgebracht zu werden. Mir bleibt nur die Möglichkeit, live zu spielen, während sich diese Mechanismen hoffentlich in etwas Positives für mich umwandeln. Dafür spiele ich.
Bewegen Sie also immer noch die Träume von einer gerechten Gesellschaft und von einer besseren Welt?
Ja. Wenn ich keine Träume hätte, dann wäre ich schon tot.
Sie haben Träume in Ihrer Che-Guevara-Widmung »Son los sueños todavia« besungen – ein Lied, das wie viele andere für die Revolution, für Freundschaft, ein unabhängiges Kuba und die großen Hoffnungen der Menschheit einsteht. Wie ist es im heutigen Kuba um die Träume bestellt?
Das Problem besteht darin: Innerhalb der Revolution gibt es Bürokratie und reaktionäres Verhalten. Das vollzieht sich verdeckt im Rahmen des revolutionären Images. Wenn ich an die Revolution denke, dann denke ich an den Teil, der aufbaut und verbessert. Diejenigen, die den negativen Teil repräsentieren, gilt es wegzuschieben. Aber sie sind da. Sie haben Wurzeln – und sie verfügen über Macht.
Macht auch über die Produktion von Platten und die Medien. Wie sieht es z. B. im Bereich Fernsehen aus?
In den kubanischen Fernsehprogrammen findet man Auftritte, die vergleichbar sind mit dem, was in Miami produziert wird. Eine Mittelmäßigkeit von Künstlern ist prägend, so dass man die Hände über dem Kopf zusammenschlägt. Dabei weiß man um die außerordentliche Qualität und den Reichtum der kubanischen Musik, und man fragt sich: Wie kommt es, dass diese Künstler in den Medien präsentiert werden – und nicht das Genuine, das Reale, das Wahrhaftige und das Schönste der kubanischen Kultur? Das könnte gefährliche Folgen für die Revolution haben.
Das geschieht in einer Zeit, in der sich die Beziehung zu den Vereinigten Staaten nach über 50 Jahren der Blockade normalisieren könnte – was aber nicht bedeutet, dass die USA ihren aggressiven, imperialistischen Charakter verloren hätten. Die Methoden im Kampf gegen die kubanische Revolution mögen sich ändern, das Ziel nicht. Die Träume Che Guevaras gegen die Traumfabrik Hollywood sozusagen. Wie sehen Sie diese Auseinandersetzung?
Die kubanische Musik könnte dem Phänomen des US-Marktes vor allem mit einem entgegentreten: mit ihrer Kreativität. Authentizität und die profunden kulturellen Werte sind stark verankert und ein Gegenmittel. Natürlich existieren Einflüsse der US-Musik. Der Prozess ist offen, und auch wir sind offen dafür, unsere Musik mit all den verschiedenen Genres anderer Länder zu bereichern. Ausgangspunkt muss aber immer bleiben, unsere Musik in ihrer Vielfalt zu erhalten – das geht von der alten Musik über Rumba, Bolero und Cha-Cha-Cha bis zu Trova, Jazz, Rock‘n‘Roll …
Sie bauen auf die Kraft der Wurzeln?
Deren Kraft ist stark. Fragilität besteht in der Frage des Bewusstseins, in der vorgegebenen Notwendigkeit, seine Musik zu platzieren, also sich zu legitimieren. Alle Musiker möchten natürlich in den USA auf Tournee gehen und sehen den Markt dort als wichtig an. Alle möchten für den Grammy nominiert werden. Und all diejenigen, die nominiert werden oder einen Grammy bekommen, werden auf diese Weise in einer Art Hierarchie über diejenigen gestellt, die nicht berücksichtigt wurden – und über deren Mittel und Ausdruck. Es interessiert nicht, über welche Tiefgründigkeit die Arbeit derjenigen verfügt, die keinen Grammy erhalten haben und die nicht von der Musikindustrie der USA unterstützt werden.
Die »Sonderperiode« zu Beginn der 1990er-Jahre hat dazu geführt, dass auch viele Künstler Kuba in Richtung USA oder Europa verlassen haben. Sie sind damals zusammen mit den anderen Großen der zweiten Nueva-Trova-Generation geblieben. Warum?
Ich bin auf Kuba geblieben, weil ich überzeugt war, dass ich bleiben muss. Zudem war ich einer Meinung mit den Freunden aus meiner Künstlergeneration. Trotzdem möchte ich niemanden kritisieren von denjenigen, die weggegangen sind. Es war schließlich eine sehr, sehr harte Zeit, und nicht alle Menschen kommen zu den gleichen Schlussfolgerungen. Es gab Engpässe. Die Menschen wollten eine andere Welt kennenlernen und selbst erleben, ob diese Welt besser ist. Deshalb sind sie gegangen. Einige von ihnen sind wieder zurückgekehrt, andere haben dann ihr Leben im Ausland weitergeführt. Viele von denen sind für Kuba viel nützlicher als einige, die immer hiergeblieben sind.
Zusammen mit Carlos Varela, dem mittlerweile verstorbenen Santiago Feliú und Frank Delgado erlangten Sie Berühmtheit als »Die Ketzer«, die in der »Sonderperiode« nicht den bequemen Weg ins Ausland gegangen sind. Wie wichtig sind Ketzer heute?
Die Bewegung besitzt historische Kontinuität. Man wünschte sich, dass die Geschichte anerkannt wird. Das ist auch eine Möglichkeit, Widerstand zu zeigen gegen all die leeren Botschaften, die im Umlauf sind. Wir werden weiterhin Ketzer bleiben.
Den Artikel lesen Sie in der Melodie und Rhythmus 4/2016, erhältlich ab dem 1. Juli 2016 am Kiosk, im Bahnhofsbuchhandel oder im Abonnement. Die Ausgabe können Sie auch im M&R-Shop bestellen.
Ähnliche Artikel:
Anzeigen


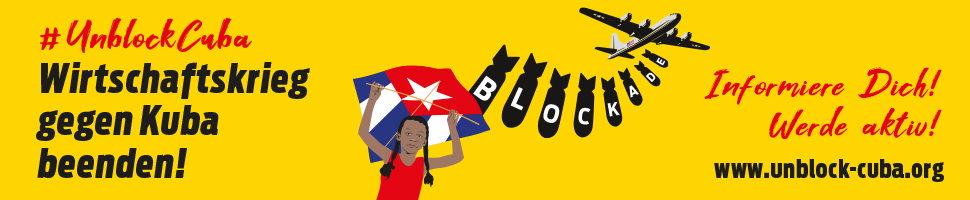

 Fotos von Katja Koschmieder und Jens Schulze
Fotos von Katja Koschmieder und Jens Schulze








