
Foto: Reuters
Zum Verhältnis von Kolonialismus und Musik
Lukas J. Hezel
»Die koloniale Gewalt hat nicht nur den Zweck, diesen unterdrückten Menschen Respekt einzujagen, sie versucht sie zu entmenschlichen. Mit nichts
wird gespart, um ihre Traditionen zu vernichten, um ihre Sprache durch die unsere zu ersetzen, um ihre Kultur zu zerstören«
(Jean-Paul Sartre)
 Die spanischen Eroberer betraten die »Neue Welt« mit einem welthistorischen Paukenschlag. Und das ist mehr als eine bloße Metapher. Die blutigen Raubzüge des Kolonialismus wurden von Anfang an musikalisch begleitet. Berühmt geworden ist die Szene, als Hernán Cortés, der Eroberer Mexikos, 1519 in die Hauptstadt des Aztekenreichs einmarschierte. Tenochtitlan war damals um ein Vielfaches größer als die mächtigsten Städte Europas und ließ die Spanier vor Ehrfurcht und Staunen erzittern. Der Herrscher Moctezuma II, der Cortés für den Gott Quetzalcoatl hielt, ließ diesen feierlich in Empfang nehmen. Die Eroberer marschierten in militärischer Formation in die Stadt ein, ihre Anführer hoch zu Ross, während die Einwohner ihnen Geschenke darbrachten. Die Hufe und Militärstiefel zertrampelten den eigens ausgestreuten, kilometerlangen Blumenteppich zum Takt eines spanischen Marsches. Es war dieselbe bedeutungsschwere Musik, die man gespielt hatte, als knapp drei Jahrzehnte zuvor (1492, dem Jahr der »Entdeckung« Amerikas) in Vollendung der Reconquista die letzten Mauren aus Granada vertrieben worden waren. Nun stand Spanien in einem neuen »Heiligen Krieg«.
Die spanischen Eroberer betraten die »Neue Welt« mit einem welthistorischen Paukenschlag. Und das ist mehr als eine bloße Metapher. Die blutigen Raubzüge des Kolonialismus wurden von Anfang an musikalisch begleitet. Berühmt geworden ist die Szene, als Hernán Cortés, der Eroberer Mexikos, 1519 in die Hauptstadt des Aztekenreichs einmarschierte. Tenochtitlan war damals um ein Vielfaches größer als die mächtigsten Städte Europas und ließ die Spanier vor Ehrfurcht und Staunen erzittern. Der Herrscher Moctezuma II, der Cortés für den Gott Quetzalcoatl hielt, ließ diesen feierlich in Empfang nehmen. Die Eroberer marschierten in militärischer Formation in die Stadt ein, ihre Anführer hoch zu Ross, während die Einwohner ihnen Geschenke darbrachten. Die Hufe und Militärstiefel zertrampelten den eigens ausgestreuten, kilometerlangen Blumenteppich zum Takt eines spanischen Marsches. Es war dieselbe bedeutungsschwere Musik, die man gespielt hatte, als knapp drei Jahrzehnte zuvor (1492, dem Jahr der »Entdeckung« Amerikas) in Vollendung der Reconquista die letzten Mauren aus Granada vertrieben worden waren. Nun stand Spanien in einem neuen »Heiligen Krieg«.
Musik erscheint hier als Instrument kolonialer Herrschaft. Einerseits wird sie gezielt als Mittel der Machtdemonstration und Einschüchterung eingesetzt; andererseits dient sie den Eroberern dazu, sich selbst in ihrer welthistorischen Mission und ihrem Sendungsbewusstsein zu bestärken. So oder ähnlich wiederholten sich die musikalische Inszenierung und die sakralisierende Selbstvergewisserung der jeweiligen Kolonialmächte unter den verschiedenen europäischen Bannern in Afrika, Asien und der Südsee. Die militärische Marschmusik der Kolonialheere wurde zur ersten Vorbotin der anbrechenden blut- und schweißtriefenden Weltzivilisation.
Von Anfang an war die Kirche die wichtigste kulturelle Institution, besonders in den iberoamerikanischen Kolonien. Dort wurde die Musik systematisch als Medium eingesetzt, um den Kolonisierten nicht nur den Glauben an den Gott der Metropole, sondern auch Demut und Bewunderung gegenüber der von den neuen Herren beanspruchten zivilisatorischen und ästhetischen Überlegenheit der weißen Eroberer einzuflößen. Die Kolonialherren hatten nicht nur das Gewaltmonopol an sich gerissen, sondern auch das Monopol auf alles Schöne, Ewige und Heilige.
Da sie auch über Sprachbarrieren hinweg erfahrbar ist und emotionale Eindrücke zu erzeugen vermag, war die Musik dabei ein besonders wirksames Mittel. Es waren die Harmonien der Kirchenchöre und Orgeln, die zuerst neue Normen und Maßstäbe der Schönheit und Erhabenheit setzten. Gleichzeitig hämmerte der Schlag der bronzenen Kirchenglocken den Unterworfenen den Lebens- und Sterbensrhythmus der kolonialen Ordnung ein. Im selben Maße, wie der Klang der Glocken die Hoffnung auf eine jenseitige Erlösung aus dem Elend in die kolonisierte Welt trug, fungierte er als Schrittmacher des Arbeitstages unter der Knute der Kolonialherren und fesselte die Eroberten umso enger an ihre trostlose Existenz im christlichen Diesseits.
Indem der Kolonialismus auf seinem Vormarsch immer mehr Menschen unter sein Joch zwang, konnte er nicht anders, als mit jedem Schritt vorwärts zugleich das Weltheer seiner eigenen Totengräber zu vergrößern. Nicht nur die Eroberung und Unterwerfung, sondern auch der Widerstand gegen die Kolonialherren hatte immer eine musikalische Dimension. Dies zeigt sich nicht zuletzt im hartnäckigen Überleben der musikalischen Traditionen der kolonisierten Völker, wenn auch immer unter dem Anpassungsdruck der weißen »Hochkultur«.
Genauso, wie die Kolonisierten bald lernten, die Waffen ihrer weißen Herren gegen die Peiniger zu erheben, lernten sie auch, auf deren Instrumenten ihre eigenen Lieder zu spielen. Die Musik wurde zur Waffe des Widerstands. Die Unterdrückten begannen, den Verhältnissen ihre eigene Melodie vorzuspielen. Beobachten lässt sich dieses musikalische Erwachen überall dort, wo der Kampf um die Unabhängigkeit von einer breiten Volksbewegung getragen wurde. Der mit dem Anbruch des 19. Jahrhunderts einsetzende Befreiungskampf der amerikanischen Kolonien atmete nicht nur die Philosophie der europäischen Aufklärung, sondern er wurde zudem getragen vom Pathos der Marseillaise. Der revolutionäre Geist der Metropole erfasste die Geknechteten und kehrte sich gegen die Herrschenden, die dort residierten.
In Lateinamerika lebt das musikalische Erbe der Unabhängigkeitskriege bis heute in den Nationalhymnen vieler Länder fort. In Venezuela zum Beispiel ist die Hymne »Gloria al Bravo Pueblo« allgemein als »La marsellesa venezolana« bekannt. Geschrieben und komponiert wurde das Stück von Vicente Salias und Juan José Landaeta, zwei Künstlern der Befreiungsbewegung, die von den Spaniern 1814 als Aufständische hingerichtet wurden. Das Lied ruft offen zur Rebellion gegen die Kolonialmacht auf: »Ruhm dem mutigen Volk / Das das Joch abschüttelte / […] Nieder mit den Ketten / […] Tod der Unterdrückung!«
Wurde der Kampf um die Unabhängigkeit auch politisch zumeist angeführt von den kreolischen Kolonialeliten, so konnten diese doch nur mit Hilfe der versklavten Massen siegen. Die weitverbreiteten Volkslieder, die in Lateinamerika besonders in den Revolutionsphasen als Massenkultur von unten entstanden, halten dem bürgerlichen Glücksversprechen der aufgeklärten Metropole den Spiegel ihrer eigenen Unmenschlichkeit entgegen, indem sie die Not und das Leiden des alltäglichen Lebens der Kolonialvölker schildern. Es war nicht zuletzt die Musik, die dazu beitrug, die kolonialen Verhältnisse zum Tanzen zu bringen.
Frantz Fanon beschreibt diesen Prozess des kulturellen Wiedererwachens im Kontext der afrikanischen Befreiungskriege: »Im Tanz, im Lied, in den traditionellen Riten und Zeremonien entdeckt man (einen) Aufschwung. […] Lange vor der politischen oder bewaffneten Phase des nationalen Kampfes kann ein aufmerksamer Leser also spüren und sehen, wie sich die neue Kraft, der bevorstehende Kampf ankündigt. […] Indem der Kolonisierte die Intentionen und die Dynamik des Kunsthandwerks, des Tanzes und der Musik, der Literatur und des mündlich überlieferten Heldengesanges erneuert, gewinnt auch seine Wahrnehmung eine andere Struktur. Die Welt verliert ihren Fluch.« Die kulturelle Selbstentfremdung, die die koloniale Herrschaft in den Beherrschten erzeugt, wird nun allmählich gebrochen. Jetzt, im Erwachen des aktiven Widerstands, dient Musik wieder den eigenen Zwecken, dem Ausdruck der eigenen Erfahrungen, Interessen und Bedürfnisse, nicht denen der weißen Kolonialherren.
Die formale Unabhängigkeit der ehemaligen Kolonien ändert bis heute wenig an der ungebrochenen Vorherrschaft des Imperialismus. Die musikalische Landschaft der kulturindustriellen Metropolen dagegen hat sich durch die Dekolonisierung umso radikaler gewandelt. In der postkolonialen Pop-Diaspora zirkuliert die Musik in beide Richtungen, vom Zentrum in die Peripherie und umgekehrt. Es gibt heute kaum mehr ein Genre, das seinen Ursprung nicht in den ehemals kolonisierten oder versklavten Teilen der Weltbevölkerung hat. Angefangen mit Jazz und Blues, den ersten afroamerikanischen Musikstilen, die massiven Einfluss auf den weißen Mainstream ausübten, ließe sich die Liste beliebig lang fortführen: Rock’n’Roll, Soul, Reggae, Ska, R’n’B, Hip-Hop und eine schier unüberschaubare Vielfalt an elektronischen Musikstilen. Die moderne Popmusik ist ein Produkt des Kolonialismus. Heute feiern die Kinder der Eroberer zu den Beats der ehemals Eroberten. Es scheint fast so, als wären es die Metropolen, deren Kultur nun von ihren befreiten Kolonien aus kolonisiert wird.
Kaum jemand verkörpert so emblematisch den Sound der globalisierten World Town wie die britisch-tamilische Künstlerin M.I.A. In ihrem Stil verschmelzen Elemente aus Pop, Hip-Hop und Dancehall zu einer eklektischen Mischung aus sich überlagernden Samples der verschiedensten musikalischen Einflüsse des globalen Südens. M.I.A. inszeniert ihre Musik provokativ als Waffe und stilisiert sich dabei selbst als Kämpferin gegen den weißen Kulturimperialismus: »Pull up the people, pull up the poor / […] I‘ve got the bombs to make you blow / I got the beats to make it bang, bang, bang.« Leiht M.I.A. damit den »Verdammten dieser Erde« ihre Stimme – zum Beispiel den Kuduro-Künstlern aus den Elendsvierteln von Angola oder den Jugendlichen aus der Favela, die sie in ihren Stücken sampelt –, oder macht sie sich nur deren exotischen Glamour zunutze, um ihre eigene Ware auf dem Marktplatz der Kulturindustrie unverwechselbar zu machen?
Der marxistische Kulturwissenschaftler Stuart Hall erklärt den komplexen Zusammenhang von Kultur und Macht wie folgt: »Populärkultur ist einer jener Orte, wo der Kampf für oder gegen eine Kultur der Mächtigen sich abspielt: Sie ist auch der Einsatz, der dabei gewonnen werden oder verloren gehen kann. Sie ist die Arena von Zustimmung und Widerstand.« Wie alle Erzeugnisse der Kulturindustrie bewegt sich auch die Popmusik im ständigen Spannungsfeld der Dialektik zwischen Kritik und Affirmation. Musik kann dazu beitragen, die herrschenden Verhältnisse anzugreifen, dient aber auch dazu, sie zu verschleiern. Rebellion läuft im Rahmen der Kulturindustrie immer Gefahr, in den Hegemonie erzeugenden Apparat integriert und dadurch affirmativ gewendet zu werden. War der Blues ursprünglich der Ausdruck des Leidens der schwarzen Sklaven, das kulturelle Medium ihres spontanen Klassenbewusstseins, so floss er ein in die Protestkultur der 1960er-Jahre, die Bewegung gegen den Vietnamkrieg, der Freaks und Hippies, um schließlich zum Teil des popkulturellen Mainstreams zu werden. Als seinem Entstehungskontext entfremdetes Konsumprodukt, welches das Feeling der Rebellion nur noch als oberflächlichen Schein vermittelt und dabei tatsächlich zum Mittel der »repressiven Entsublimierung« (Herbert Marcuse) wird, hat die musikalische Form ihren kritischen Inhalt verloren. Wenn sich das Gefühl der Rebellion als harmlose Kulturware kaufen und genießen lässt, dann wird die wirkliche Rebellion überflüssig. »Wenn das Anhören einer Platte umstandslos für etwas Widerständiges gehalten wird, dann bedeutet Widerstand rein gar nichts«, wie der Musiksoziologe Simon Frith feststellt. Sex, Drugs and Rock’n’Roll stehen nicht notwendig im Widerspruch zu Imperialismus und Krieg, sie laufen immer Gefahr, vom Schrei der Empörung gegen die Verhältnisse zu ihrem Soundtrack zu werden. In den Napalm-Bombern und Schützenlöchern in Vietnam lief die Musik von Jimi Hendrix …
Wenn heute die Rapper von Dead Prez im Slang der Straße die schwarze Jugend darüber aufklären, wie der Rassismus und die Gewalt der weißen Cops, ihre Probleme in der Schule und die Armut in ihrem Viertel mit der kolonialen Vergangenheit zusammenhängen, dann ist das subversiv: »I’m an African, I’m an African / And I know what’s happening!« Wenn 50 Cent dagegen denselben Jugendlichen, Kindern befreiter Sklaven, die Illusion eines weißen amerikanischen Traums verkauft (»Get Rich or Die Tryin’«), dann ist das neoliberale Ideologie unter der Tarnkappe der Musik der Unterdrückten.
Den Artikel lesen Sie in der Melodie und Rhythmus 4/2015, erhältlich ab dem 26. Juni 2015 am Kiosk, im Bahnhofsbuchhandel oder im Abonnement. Die Ausgabe können Sie auch im M&R-Shop bestellen.
Ähnliche Artikel:


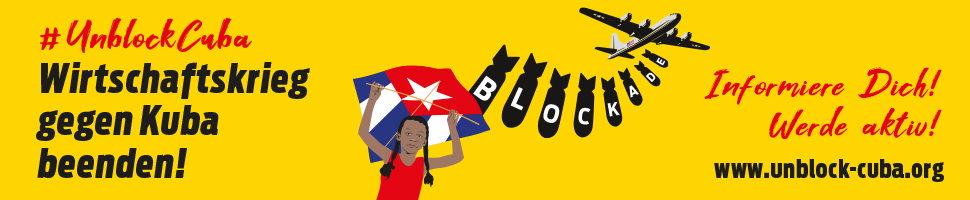

 Fotos von Katja Koschmieder und Jens Schulze
Fotos von Katja Koschmieder und Jens Schulze








