
Foto: Picture Alliance/akg-images
Die Konfrontation der Kulturen hat einen wechselseitigen Prozess der Veränderung und Bewusstwerdung ausgelöst, der längst nicht abgeschlossen ist. Es gibt keine Unterjochung, ohne dass die unterdrückte Kultur auf die herrschende zurückwirkt, sie unterminiert und verändert
Diego Castro
 »Ein Indiojunge aus Peru / Er will leben so wie du.« Mit diesem banalen Reim eröffnete Katja Ebstein ein neues Kapitel im deutschen Schlager. Nach Heim- und Fernwehsülze kam der Bewusstseinsschlager, mit dem sich philisterhaft der moralische Zeigefinger in der deutschen Wohnstube erheben sollte. Nach den Beschwörungen ferner Welten als kitschige Staffage für Seemannsgarn und Landser-Nostalgie eines Freddy Quinn kam die Einsicht: Die Menschen der Dritten Welt haben es auch nicht leicht. »Am Fudschijama blüht kein Edelweiß«, »Es gibt kein Bier auf Hawaii« – der »Indiojunge aus Peru« brachte schließlich musikalisches Brot für die Welt. Die Kinder der Eingeborenen von Trizonesien hatten mit Ostermarsch und Friedensbewegung gegen die oberdeutsche Elterngeneration rebelliert. Fremde Kulturen kamen über den Hippie-Trail. Als Blumenkind Ebstein dann ans Schlager-Ruder durfte, steuerte sie bei vollem Bewusstsein auf die Klippen des Kitsches zu. Wohlwollen allein machte den Schlager leider nicht besser, denn was auf Burg Waldeck inhaltlich noch möglich war, zerschellte am Felsen der ZDF-Hitparade. Unfreiwillig zeigte sich mit solch biedermeierlichen Vorstellungen, wie tief koloniale Muster verankert sind. Das mildtätige Lied ist ein anschauliches Beispiel für die Subjektwerdung des »Anderen«. Die Entkolonisierung des Blicks ist indes eine schwierige Übung.
»Ein Indiojunge aus Peru / Er will leben so wie du.« Mit diesem banalen Reim eröffnete Katja Ebstein ein neues Kapitel im deutschen Schlager. Nach Heim- und Fernwehsülze kam der Bewusstseinsschlager, mit dem sich philisterhaft der moralische Zeigefinger in der deutschen Wohnstube erheben sollte. Nach den Beschwörungen ferner Welten als kitschige Staffage für Seemannsgarn und Landser-Nostalgie eines Freddy Quinn kam die Einsicht: Die Menschen der Dritten Welt haben es auch nicht leicht. »Am Fudschijama blüht kein Edelweiß«, »Es gibt kein Bier auf Hawaii« – der »Indiojunge aus Peru« brachte schließlich musikalisches Brot für die Welt. Die Kinder der Eingeborenen von Trizonesien hatten mit Ostermarsch und Friedensbewegung gegen die oberdeutsche Elterngeneration rebelliert. Fremde Kulturen kamen über den Hippie-Trail. Als Blumenkind Ebstein dann ans Schlager-Ruder durfte, steuerte sie bei vollem Bewusstsein auf die Klippen des Kitsches zu. Wohlwollen allein machte den Schlager leider nicht besser, denn was auf Burg Waldeck inhaltlich noch möglich war, zerschellte am Felsen der ZDF-Hitparade. Unfreiwillig zeigte sich mit solch biedermeierlichen Vorstellungen, wie tief koloniale Muster verankert sind. Das mildtätige Lied ist ein anschauliches Beispiel für die Subjektwerdung des »Anderen«. Die Entkolonisierung des Blicks ist indes eine schwierige Übung.
Mit vermeintlich aufgeklärter Sicht malte man die kolonisierte Welt als Ideallandschaft, in der »edle Wilde« lebten, in deren Kultur die Kolonialmacht hereinbrach und alles zerstörte. Immerhin ein teilweises Eingeständnis der eigenen Erblast. Doch wer in den Menschen des Trikont nur ihrer Identität beraubte Opfer sieht, denkt falsch. Natürlich haben die Kolonialmächte mit ihrer mörderischen Gier unvorstellbares Leid gebracht. Kulturell haben sie arg gewütet. Mit der Ausbeutung von Ressourcen, dem Raub von Kulturgut, Ikonoklasmus und der Arroganz gegenüber indigener Kultur wurde den Kolonisierten nicht wiedergutzumachender Schaden zugefügt – zweifelsohne. Doch gehen wir einen Schritt weiter. Was sagt uns die Popkultur über die Kolonialzeit? Interessant ist die Perspektive auf den letzten Teil ihrer Geschichte, der geprägt ist von der industriellen Revolution. Mit ihr begann in den Kolonien eine kulturelle Emanzipation, deren Apologeten Mahatma Gandhi oder Frantz Fanon waren. Die Frage des radikalen Ausschlusses stellt sich an ihr neu. Ob die Subalterne singen kann, ist gar keine Frage. Die Frage ist, ob wir ihr zuhören können.
Der koloniale Blick ist eine gefärbte Sichtweise. Diese aber kennt verschiedene Schattierungen. So beinhaltet er neben krudem Rassismus auch paternalistisches Wohlwollen. Die erwähnten »edlen Wilden« durften sich der kolonialen Projektionen »erfreuen«, die mit dem Bild des unverdorbenen Naturmenschen – jenseits von Gut und Böse – das Licht der Gnade auf sie warfen. Gleichzeitig aber wurde das koloniale Subjekt von gleichen Rechten ausgeschlossen und seine Kultur als primitiv verpönt. Die eigene Kultur galt den Kolonialherren als höher entwickelt; die eigene verlorene Unschuld war hierfür das Unterpfand. Der koloniale Blick nahm indigene Kulturen bestenfalls als reizende Folklore wahr. Es dauerte bis tief ins 20. Jahrhundert, bis europäische Intellektuelle zaghaft begannen, die Kulturen Afrikas, Asiens und Amerikas ernst zu nehmen. Zwischen »Urwaldgetrommel« und differenzierter Wahrnehmung nichteuropäischer Musik lag ein langer Prozess. Er bedurfte neben der Befreiung vom Kolonialsystem der Arbeit der Emanzipationsbewegungen und der Entkolonialisierung des Blicks.
Alain Resnais‘ und Chris Markers »Les Statues meurent aussi« war dafür ein exemplarischer Dokumentarfilm, der zum ersten Mal die eurozentrische Arroganz des Blicks kritisierte. Nach seiner Uraufführung war er zehn Jahre lang verboten. Der Abzug der französischen Kolonialmacht aus Afrika war politisch vollzogen, doch in den Köpfen lebte der Glaube an die kulturelle Überlegenheit weiter. Auch heute sieht man, wie die Bevölkerung aus den ehemaligen Kolonien in Frankreich oder Belgien täglich mit Kulturchauvinismus zu kämpfen hat. Doch auch jene, die fremde Kulturen mit offenen Armen empfangen, müssen vom kolonialen Blick nicht frei sein. Paul Simons »Graceland« oder eine Platte von Manu Chao im Plattenregal heißt nicht, dass man sich Projektionen enthält. Im Gegenteil: Die »Weltmusik« ergießt teilweise einen unglaublichen Kitsch in die Gehörgänge der westlichen Welt. Vom Lebensfreudemythos für verhärmte Protestanten bis zu mittelständischen Revolutionsphantasien ist alles dabei. Ein immer wiederkehrendes Motiv: Ursprünglichkeit.
Die Suche nach dieser Ursprünglichkeit verkennt einen wichtigen Aspekt rigoros. Die letzte Welle imperialistischer Interventionen in der postkolonialen Welt wird zu Recht auch als kulturimperialistisch bezeichnet. So richtig, so falsch. Denn die Erben des Kolonialismus haben ein Recht auf Modernisierung und Neuerfindung des Trikont. Die Zeit der Emanzipationsbewegungen ab den 1950er-Jahren war auch eine Zeit, in der junge Musik auf dem ganzen Planeten Weltgeist atmete. Gerade die Hybridisierungen, die Tradition und Folklore durch den Kontakt mit amerikanischer Musik erfuhren, sind maßgeblich für die Entstehung fast aller musikalischer Stile, die wir heute im Pop kennen. Diese Stilgeschichte ist eine Chronik der Verwechslungen.
Natürlich war das Südamerika- Bild ein falsches, wenn Marika Rökk in Deutschland hölzern zu einem synkopischen Mambo-Beat galoppierte. Und der Popocatépetl-Twist hatte mit der Realität nicht eben viel am Mexikaner-Hut. Nichtsdestotrotz gelangte durch Jazz, der bei vielen Fusionen von Musikstilen Scharnierfunktion hatte, unmerklich Aufruhr in den behäbigen Viervierteltakt der »Alten Welt«. Heute können wir über die Missverständnisse lachen. Der wirkliche Einfluss bleibt oft unbemerkt. Nicht nur die ehemaligen Kolonien wurden europäisch geprägt. Auch die ehemaligen Mutterländer wurden von Kulturerzeugnissen aus den Kolonien beeinflusst. Die Geschichte bleibt keineswegs bei der Anpassung der Weißen an indigene Symbolik zum Zweck der Machtetablierung in den Kolonien und bei der Angleichung der Kolonialbeherrschten an die Herrenkultur stehen.
Als europäische Forscher anfingen, das Leben indigener Stämme zu dokumentieren, rechneten sie mit einem nicht: der Fähigkeit der Forschungsobjekte zu subversiver Praxis. Viele der ethnografischen Filme über Indianer oder Polynesier sind das Ergebnis von Inszenierungen, bei denen man die Wissenschaftler schlichtweg veräppelte. Die weißen Männer nahmen es für bare Münze. So bildeten sich Legenden von Wildheit und Magie als Essenz. Vielfach zeigte sich jedoch später die Fähigkeit von »Eingeborenen«, souverän mit dem Einfluss westlicher Medien umzugehen.
Das uramerikanischste Genre ist vielleicht der Western. Seine Soundtracks beeinflussten die Kids auf der ganzen Welt auch musikalisch. In Asien lösten sie eine Welle von Gitarrenbands à la Shadows aus. In Afrika gab es eine Jugendkultur, die sich komplett dem Wilden Westen verschrieben hatte. Die »Bills«, benannt nach Buffalo Bill, waren Ende der 1950er-Jahre eine Subkultur, deren Anhänger im Cowboy-Outfit auf Fahrrädern Reiterakrobatik vollführten. Sie sahen sich als Gegenbewegung zu den Evolués, den aufstrebenden jungen Afrikanern, die durch Assimilation an die belgische Kolonialmacht den Aufstieg erreichen wollten. Im Kongo oder an der Elfenbeinküste revoltierten die Bills durch das Absorbieren amerikanischer Popkultur gegen die französische oder belgische Herrschaft: Es kommt immer darauf an, genau hinzusehen, was mit den kulturellen Einflüssen geschieht. Jean Rouch hat mit dem Dokumentarfilm »Moi, un noir« eher zufällig die Bills dokumentiert. Sie tanzten Rock’n’Roll zu Straßenmusik: Blues-Gesang wurde mehr oder weniger imitiert, dazu kamen polyrhythmische Trommeln. In dieser Art von Hybridisierung liegt die Grundlage moderner Musikstile.
Tonträger waren in jenen Tagen kaum verbreitet. Das Radio wurde von Afrika bis Asien Medium Nummer eins. In der Entstehungszeit des Rock’n’Roll wurde es im segregierten Amerika erst durch das Radio möglich, dass Weiße schwarze Musik hörten. Auf Jamaika empfing man nordamerikanische Soldatensender, die R’n’B spielten. Dieser mischte sich bei der Reinterpretation u. a. mit Calypso, die Metrik verschob sich, und Ska war geboren – ein originärer Musikstil. Die Geschichte von musikalischem Im- und Export ist weit gefächert. Auf Jamaika gab es neben Ska auch Soul und sogar Country. Letzterer war, trotz seiner Ausrichtung auf ein weißes Zielpublikum und oftmals rassistischer Tendenzen, auf Jamaika sehr beliebt und brachte Songs hervor wie Lloyd Charmers‘ »Dollars and Bonds« oder Claude Grays »I’ll Just Have Another Cup of Coffee«, der zu Bob Marleys zweiter Hit-Single wurde. Import ist aber nur eine Seite der Medaille, denn musikalische Kolonialware kehrte auch zurück in die Mutterländer und entwickelte sich weiter. Mit der Unabhängigkeit 1962 gelangten viele jamaikanische Einwanderer nach Großbritannien und mit ihnen der Offbeat. Der Bluebeat, wie der Ska zunächst genannt wurde, erfuhr sofort großen Zuspruch. Die jamaikanischen Rudeboys waren die coolste Subkultur. Mit ihren engen Anzügen, kleinen Hüten und Sonnenbrillen machten sie mächtig Eindruck auf die Mods, und aus der Fusion der beiden wurde der Skinhead. Als nach Punk die britischen Jugendkulturen ein Revival erlebten, begannen Bands wie The Specials, The Selecter oder The Beat unter dem Label »2 Tone« musikalische Elemente aus Punk, Wave und Ska zu mischen und damit – in Zeiten des Aufstiegs der National Front – ein antirassistisches Statement zu verbinden.
Die Subversionspraxis der Black Community von New Orleans, von der Pop-Theoretiker George Lipsitz zu berichten weiß, bediente sich während des Mardi Gras der Kostümierung. Die Mitglieder verkleideten sich als Indianer. Mit dieser Reminiszenz von Afroamerikanern an die Ureinwohner der USA vollzog sich ein Protest, in dem die Schwarzen die Weißen als Kolonisierer anklagen konnten, ohne offen politisch zu demonstrieren. »Antiessenzialistische Praxis« nennt Lipsitz die Strategie, nicht der zugeschriebenen Kultur entsprechend zu agieren. Die Bands des New Yorker Boogaloo (Tito Puente, Joe Bataan) besannen sich in den 70ern mit dem Afrocuban- Sound als Puerto Ricaner auf entfernte afrikanische Wurzeln und riefen damit ihre marginale Existenz in ähnlicher Weise in Erinnerung wie die Afroamerikaner. Zeitgleich bildeten sich die puerto-ricanischen Young Lords als Antwort auf die Black Panthers. Die Vorbilder der hierzulande wenig beachteten Punkbewegung der Chicanos hatten weder Latino-Wurzeln, noch vollzogen sie eine Anbiederung an die US-Kultur. Bands wie Los Illegals oder The Brats orientierten sich an britischen Punkbands, nicht an amerikanischen. Damit drückten sie nicht nur ihre Ablehnung der Assimilierung an die USA aus, sondern befeuerten auf ironische Weise den amerikanischen Minderwertigkeitskomplex gegenüber der europäischen Kultur. Britische Alienation wurde zum Sinnbild der Entfremdung der mexikanischstämmigen Einwohner von Los Angeles als Bürger zweiter Klasse. Die starke Betonung der Klassenfrage durch den UK-Punk füllte eine Lücke im wenig klassenbewussten US-Punk. Vor diesem Hintergrund ist die bis heute anhaltende Vergötterung Morrisseys bei den kalifornischen Latinos längst nicht so verwunderlich, wie die Artikel über das Phänomen in der britischen Musikpresse vermuten lassen. Diese Fankultur ist vollkommen antiessenzialistisch und wird daher auch von vielen Außenstehenden nicht verstanden. Der koloniale Blick richtet sich eben nicht nur kulturchauvinistisch auf die Eingeborenen in weit entfernten Ländern, sondern auch exkludierend auf die Einwanderer in der unmittelbaren Nachbarschaft.
Den Artikel lesen Sie in der Melodie und Rhythmus 4/2015, erhältlich ab dem 26. Juni 2015 am Kiosk, im Bahnhofsbuchhandel oder im Abonnement. Die Ausgabe können Sie auch im M&R-Shop bestellen.
Ähnliche Artikel:



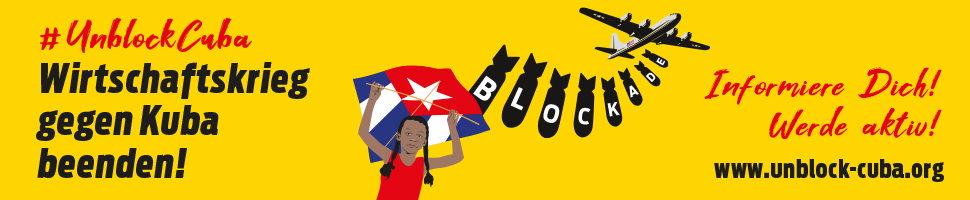

 Fotos von Katja Koschmieder und Jens Schulze
Fotos von Katja Koschmieder und Jens Schulze








