
Foto: Johann Stemmler
Nicolás Miquea über das Elend linker Kultur in Deutschland und revolutionäre Kunst
Interview: John Lütten
Nicolás Miquea ist Musiker und politischer Aktivist. Der gebürtige Chilene hat Gitarre in den USA und Deutschland studiert, lebt seit mehr als zehn Jahren in Berlin und engagiert sich für internationalistische Projekte.
Sie sind in Chile aufgewachsen, haben in den USA und Paraguay gelebt. Sie haben klassische Gitarre studiert und sind seit mehr als zehn Jahren in Berlin – spielen allerdings nach wie vor ausschließlich spanischsprachige Lieder. Wo sind Sie künstlerisch zu Hause?
Das kann ich nur mit Hinweis auf meine Biographie beantworten. Ich wurde häufiger befragt, ob es schwer für mich gewesen sei, mich an eine neue Kultur zu gewöhnen. Meine Antwort ist, dass es genauso schwer war, wie mich an die Kultur in Chile zu gewöhnen. Gegenüber der chilenischen Kultur und dem Bildungssystem dort hatte ich schon als Kind eine sehr kritische Haltung. Das ging so weit, dass ich schon im Alter von zwölf Jahren aus ideologischen Gründen die Schule abgebrochen und anschließend alleine zu Hause gelernt. Bei meiner Kunst es ist es ähnlich: Man kann mich nicht an einem bestimmten Ort binden, auch nicht an einen Stil. Ich wurde an mehreren Orten ausgebildet, klassische Musik zu spielen und Poesie zu schreiben. Aber ich habe letztendlich »einfache« Lieder komponiert. Das Studium der klassischen Gitarre hat mir viele Türen geöffnet – ich konnte dadurch in verschiedenen Ländern leben, und jetzt bin ich hier in Deutschland gelandet. Was die Sprache meiner Lieder anbelangt: Die Grundlage meiner Songs ist der Text, aber in der Regel verstehen 80 Prozent des Publikums nicht, was ich singe. Viele Besucher meiner Konzerte sprechen nun mal kein Spanisch. Insofern kann man sagen, dass ich eine Art Außenseiterrolle habe. Die habe ich allerdings häufig auch gesucht. Das liegt an meiner Persönlichkeit, nicht an einer bewussten Strategie oder so. Meine Kunst ist genauso heimatlos wie ich.
Ihre Musik ist leidenschaftlich und virtuos, Ihre Texte behandeln Politisches wie Persönliches in einer sehr poetischen, malerischen Sprache. Wie finden Sie, muss politische Kunst beschaffen sein?
Sie muss Kunst sein, nicht nur politische Aussage. Sie muss kreieren statt bloß vorgegebene Muster und ästhetische Regeln zu wiederholen. Wer schöne Hymnen und Parolen schreibt, kann mit Genossen auf Demos singen; wer aber, wie etwa Violeta Parra oder Bertolt Brecht, eine neue Ästhetik schafft, kann auch Andersdenkende erreichen. Der Künstler muss ehrlich sein. Das ist aber schwer, denn man merkt dann, wie sehr man von der Gesellschaft beeinflusst ist, die man kritisiert. Kunst ist eine innere Suche, und mitunter mag man nicht, was man findet. Wir sind gezeichnet von den unterdrückerischen Verhältnissen, in denen wir leben. Darum sind Künstler, die einfach nur sagen, wo es langgeht, statt auch diese Widersprüche zu benennen, kaum glaubwürdig. Brecht etwa hat agitatorische Stücke geschrieben, sich aber auch dekadent gezeigt. Diese Ehrlichkeit hat auch Menschen außerhalb des linken Lagers angesprochen. Es gibt übrigens auch revolutionäre Künstler, die keine Revolutionäre im politischen Sinne waren. Kafka etwa – er war nur kurz aktiv, und in manchen Fragen war er sogar reaktionär. Weil seine Kunst aber so kreativ und authentisch war, war sie sozialkritisch und hat die herrschenden Verhältnisse transzendiert.
Sie wurden in Chile politisiert, und Ihre Lieder zeugen von einer antiimperialistischen Grundhaltung. Wie erleben Sie die Kultur der hiesigen Linken?
In Lateinamerika werden viele Projekte und ihre Kultur selbst organisiert, weil den Leuten schlicht nichts anderes übrig bleibt – sie müssen sich gegen Unterdrückung wehren. Dort können Linke nicht einfach Theorien in der Uni entwickeln und die Bedürfnisse der Menschen ignorieren. Wer sich nicht mit konkreten Problemen der Bevölkerung beschäftigt, ist da als Linker nicht glaubwürdig. Hierzulande hingegen konzentrieren sich Linke oft auf die Situation von Menschen, die anderswo leben und die sie nicht kennen. Alternativkultur ist hier kein Mittel, um zu überleben. Und oft ist sie elitär, weil sie das Volk nicht mehr erreichen will oder gar verachtet. Ich war eine Zeit lang als Gitarrenlehrer in Mecklenburg-Vorpommern tätig und habe auch mit Inhaftierten in Gefängnissen gearbeitet. Dort habe ich mit vielen nichtpolitisierten Jugendlichen über Politik gesprochen, und in vielen Gesprächen musste ich feststellen, dass »links« für viele von ihnen ein Synonym für Arroganz war. Sie berichteten, dass Linke sie undifferenziert als Nazis beschimpften oder behauptet hätten, Dorfbewohner hätten einen schlechten Geschmack oder seien dumm, weil sie Fußball mögen etc. Ich selber habe erlebt, dass sogenannte »Antideutsche« durch Dörfer ziehen und Parolen wie »Kühe, Schweine, Ostdeutschland« und andere herablassende Sprüche brüllen. Wer so etwas tut, hat kein Interesse daran, irgendwen zu überzeugen, sondern will einfach in einer kleinen Gruppe von Auserwählten bleiben. Selbstverständlich müssen wir gerade jetzt etwa Schutz für Flüchtlinge oder Leute ohne Papiere organisieren. Aber wenn wir nicht auch etwas für z.B. Hartz IV-Bezieher in Mecklenburg-Vorpommern oder perspektivlose Jugendliche in Sachsen-Anhalt tun, dann haben AfD, Pegida und die NPD es leicht, diese Menschen zu verführen und zu agitieren. Wer, wie Teile der linken Subkultur, keine Empathie mehr aufbringt und die Massen per se für verblendet hält, treibt sie erst recht in die Arme der Rechten!
Für Ihre kritischen, vor allem für Ihre internationalistischen Positionen wurden Sie auch schon angefeindet …
Ja. 2015 hat mich eine »antideutsche« autonome Antifa aus Berlin-Neukölln von einer antirassistischen Demo geschmissen, weil ich ein »Free Palestine«-Shirt trug. Auch ein israelischer Freund wurde ausgeschlossen und als »Antisemit« und »selbsthassender Jude« beschimpft. Bei der »Linken Kinonacht«, die die Berliner Linkspartei letztes Jahr organisiert hatte, haben die Ordner meine Genossen und mich sogar körperlich attackiert. Ich war als Musiker gebucht, und nach meinem Auftritt sollten Gregor Gysi und Klaus Lederer sprechen. Darum wollten wir gegen proimperialistische Positionen protestieren, die von ihnen unterstützt werden. Wir entrollten ein Transparent mit dem Spruch »Zionismus ist nicht links«. Wir halten solche Aktionen für nötig, um auf die reaktionären Tendenzen in Teilen der linken Szene hinzuweisen. Dass wir uns damit Ärger einhandeln würden, war klar. Aber wir wurden tätlich angegriffen und dazu noch als Mitarbeiter des Verfassungsschutzes beschimpft – das war neu.
Wie müsste eine revolutionäre Gegenkultur heute aussehen?
Sie muss authentisch sein und Menschen erreichen. Was hierzulande als »linke Musik« gilt, scheint genau das vermeiden zu wollen. Mode und Attitüde ersetzen Kreativität. Ich kenne auch keine andere als die deutsche Subkultur, in der Ironie und Sarkasmus so präsent und zwanghaft sind. Von den Ärzten bis zur Antilopen Gang – man möchte beweisen, dass man links, aber gleichzeitig cool und witzig ist. Pathos ist hier ein Tabu. Dinge ironisch von oben zu betrachten, ist eben einfacher, als Gefühle und Schwäche zu zeigen. Aber politische Kunst, die nur aus Ironie und Attitüde besteht, relativiert ihre Aussage – sofern sie überhaupt eine hat. Viele meinen auch, pathetische und weniger oberflächliche Kunst erreiche die Leute nicht. Das halte ich für ein Dogma, das die Kapitalisten der Musikindustrie verbreiten, die die Masse für dumm hält. Ich bin fest davon überzeugt, dass revolutionäre Kunst genauso viele Menschen erreichen kann wie marktkonforme.
Rolf Becker rezitiert Texte von Nicolás Miquea
Konzert und Lesung
28. April 2017, 19 Uhr
Café Sibylle, Karl-Marx-Allee 72, 10243 Berlin
Das Interview lesen Sie in einer gekürzten Fassung in der Melodie & Rhythmus 2/2017, erhältlich ab dem 31. März 2017 am Kiosk, im Bahnhofsbuchhandel oder im Abonnement. Die Ausgabe können Sie auch im M&R-Shop bestellen.
Ähnliche Artikel:
Anzeigen


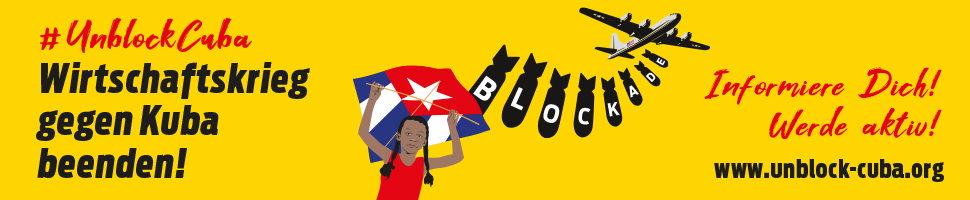

 Fotos von Katja Koschmieder und Jens Schulze
Fotos von Katja Koschmieder und Jens Schulze








