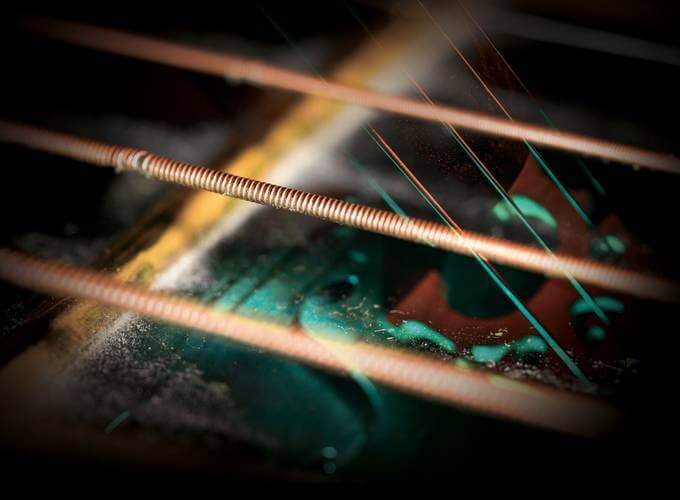
Fotos (Montage): shutterstock.com
Mit »Harakiri« schuf Nicolaus A. Huber vor 50 Jahren ein radikales »Provokationsmodell«
Rainer Nonnenmann
Sich einer »marxistisch geprüften Lebens- und Tätigkeitseinstellung« verpflichtet fühlend, formulierte Nicolaus A. Huber radikale Thesen zum Tonkunstschaffen. »Kritisches Komponieren behandelt Probleme, die den Menschen betreffen, aber sich in Musik widerspiegeln.« Es ist wesentlich analytisches Komponieren, das Auskunft gibt über Bedingungen des menschlichen Wahrnehmens, Denkens, Fühlens und Handelns, die in allen Lebensbereichen herrschen und sich deswegen auch in Musik niederschlagen. Nicht einmal für Musiker und Komponisten steht daher primär Musik im Mittelpunkt, sondern der Mensch mit seiner gesellschaftlichen Praxis. Ein kritischer Komponist macht folglich nicht einfach Kultur, »sondern leistet Arbeit, nützliche Arbeit für den Menschen«. So heißt es in seinem Manifest »Kritisches Komponieren«, das sich in seiner 2000 veröffentlichten Schriftensammlung »Durchleuchtungen« findet. Der 1939 in Passau geborene Komponist, der in den 1960er-Jahren bei Luigi Nono in Venedig studiert hatte und von diesem zum Marxisten herangebildet worden war, hat diesen kurzen Text aber schon 1972 geschrieben – um sich in der durch die studentische Protest- und Emanzipationsbewegung politisierten Musikszene sowohl von naiven Anknüpfungsversuchen an die Kampfmusiken Hanns Eislers zu distanzieren als auch vom materialimmanenten Fortschritts- und Reinheitsdenken der etablierten Nachkriegsavantgarde. Statt der Musik neue Bedeutung von außen überzustülpen, wollte er die in ihr selbst bereits angelegte gesellschaftspolitische Brisanz hervorkehren.
Die radikalste Umsetzung seines damaligen Ansatzes ist »Harakiri« für kleines Orchester und Tonband. Das Stück wurde 1970 vom Süddeutschen Rundfunk Stuttgart in Auftrag gegeben und zur Uraufführung angekündigt. Die daraufhin vom Komponisten bis Juni 1971 fertiggestellte Partitur hielt der dortige Redakteur und Programmchef für Musik jedoch für »mangelhaft«, »nicht einmal originell« und »nicht wirklich komponiert«, so dass man den Auftrag als nicht erfüllt ansah. …
Der komplette Beitrag erscheint in der Melodie & Rhythmus 1/2021, erhältlich ab dem 18. Dezember 2020 am Kiosk, im Bahnhofsbuchhandel oder im Abonnement. Die Ausgabe können Sie auch im M&R-Shop bestellen.
Ähnliche Artikel:
Anzeigen




 Fotos von Katja Koschmieder und Jens Schulze
Fotos von Katja Koschmieder und Jens Schulze








