
Foto: Vivek Prakash/Reuters
Bei Bandproben wird die Dialektik von Kollektiv und Individuum live erfahrbar
Martina Dünkelmann
Es fängt schon an, bevor wir uns überhaupt getroffen haben: »Proben morgen 17 Uhr?« – »Ich hab meiner Freundin versprochen, mit ihr essen zu gehen …« – Manche Bands schlagen sich mit Problemen herum, um die andere sie nicht beneiden. Und wenn dann auch noch jedes Bandmitglied wie in einem Kollektiv gleich viel zählen soll, werden schnell auch die Freundin des Sängers und die Beziehung der beiden zum Gegenstand stundenlanger Diskussionen. Eine basisdemokratische Abstimmung bringt hier wenig, und der Überstimmte in so einem »Band-Volksentscheid« ist immer unterlegen: Es bildet sich zwangsläufig eine situative hierarchische Struktur, in der er sich übergangen fühlt. Und die Freundin erst!
Was also tun? Bilaterale Beziehungen zur Freundin aufnehmen, um das Essen zu verschieben? Das kann noch mehr stundenlange Diskussionen zur Folge haben. Und wahrscheinlich fühlt sich die Freundin trotzdem hinterher benachteiligt, auch wenn sie »freiwillig« einem Verzicht zugestimmt hat. Glücklich, wer hier die Band gleich zu Anfang, noch bevor überhaupt irgendwelche Geschäfte und Proben aufgenommen wurden, zu einer absoluten Autorität gemacht hat, der sich alle unterordnen müssen. Feste Probetermine sind in dieser Situation ein Segen, den exterritoriale Kräfte wie Freundinnen und ihre Bedürfnisse nicht stören können. Aber widerspricht ein Kollektiv mit einer herrschenden Autorität nicht dem Gedanken des Kollektivismus? Im Gegenteil: Die Band selbst ist das Kollektiv, dessen Gemeinwohl im Vordergrund steht und dem sich alle unterordnen müssen – und sich darin wieder gleich sind. Die Unterordnung erstreckt sich auch auf die Freundin als angeschlossenes Individuum außerhalb des Kollektivs. Sie muss immer unterlegen sein, besser noch: Sie ergibt sich freiwillig. Sie erlebt eine große Machtdistanz zum Kollektiv, in dem eine geringe Machtdistanz herrscht.
Wir haben es geschafft und treffen uns am nächsten Tag um 17 Uhr zu viert im Proberaum. Der Gitarrist steckt sein Kabel in den Verstärker, dreht auf und fängt an, in einer ohrenbetäubenden Lautstärke auf seinen Saiten herumzuschrammeln. Ja, der Gitarrengott lebt in ihm weiter, während ich versuche, meinen Bass zu stimmen und Flüche in Richtung Himmel an eben jenen schicke. »Mach mal leiser!« – »Ja, schon gut …« Das Individuum muss zum Gemeinwohl beitragen, laute Ausbrüche schaden dem gemeinsamen Ziel. Gitarristen mit Hang zum Solieren sind somit von vornherein eine Gefahr für das Kollektiv. Aber ohne sie verliert die Band den Rock – nicht nur das Salz, sondern gleich die ganze Suppe.
Den kompletten Artikel lesen Sie in der Melodie und Rhythmus 6/2015, erhältlich ab dem 30. Oktober 2015 am Kiosk, im Bahnhofsbuchhandel oder im Abonnement. Die Ausgabe können Sie auch im M&R-Shop bestellen.
Anzeigen

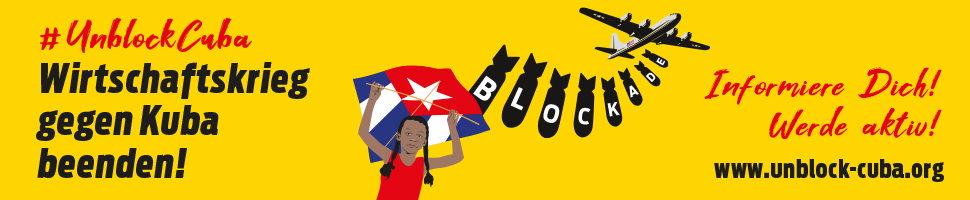

 Fotos von Katja Koschmieder und Jens Schulze
Fotos von Katja Koschmieder und Jens Schulze








