
Foto: Camille Blake
Der Komponist Frederic Rzewski über seine politischen Werke, besondere Begegnungen und sein Wirken in der DDR
Interview: Bastian Tebarth
Er gehört seit Jahrzehnten zu den bedeutendsten linken Vertretern der Neuen Musik. 1938 in Massachusetts (USA) geboren, galt Frederic Rzewski während seiner Wanderjahre zu Beginn der 1960er in Europa als hochbegabter Pianist; ab den frühen 70ern wurde er auch als politischer Komponist bekannt. M&R sprach mit Frederic Rzewski über sein wohl berühmtestes Stück »The People United Will Never Be Defeated!« und andere Werke, seine Zeit in der DDR und fragte ihn nach seiner Botschaft an die Künstler in der Coronakrise.
Als Sie Mitte der 60er-Jahre in Rom lebten, versuchten Sie mit dem Kollektiv Musica Elettronica Viva »Einheit und Harmonie zwischen den Menschen durch die Einrichtung eines Klangraums« zu erschaffen. Paralysiert heute der andauernde »Ausnahmezustand« den Widerstandsgeist?
Wie viele andere, die zu dieser Zeit nach Rom kamen, wurde ich von dem Mythos des »Dolce Vita« angezogen. Was den Widerstandsgeist heute lähmt, ist das Gleiche wie in den 1960ern: Wohlstand und Privilegien.
In den vergangenen Jahren haben Sie wieder häufiger »The People United« gespielt. Die Komposition, die Sie zur 200-Jahr-Feier der USA als Kommentar zum Pinochet-Putsch geschrieben haben, basiert auf Sergio Ortegas berühmter Hymne »El pueblo unido jamás será vencido«. Form und Inhalt der Komposition stehen in einem besonderen Verhältnis – können Sie die bitte näher beschreiben?
Es handelt sich um eine Form, die ich von der politischen Off-Theater-Gruppe Living Theatre geborgt habe – ich stand damals in engem Kontakt mit ihr – und die deren eher verwirrten Vorstellungen von Kabbala-Mystik entstammte: Es gibt sechs Möglichkeiten, wie zwei musikalische Ereignisse miteinander in Beziehung stehen können; diese werden am Ende zusammengefasst. Dieser Vorgang wird sechsmal wiederholt. Bei der Form habe ich auch John Cage und meinem Collegefreund Christian Wolff viel zu verdanken.
Einerseits gibt es diese komplexe und strenge Form, andererseits gibt die Komposition dem Interpreten Raum für ausgedehnte Improvisationen: Was bedeutet die Dialektik von Freiheit und Ordnung für Ihre Arbeit als Komponist?
Ich bin mir nicht sicher, ob da eine Dialektik im Spiel ist. Diese beiden Phänomene gehören einfach zueinander. Beide sind notwendig. Nehmen wir mal an, sie wollen eine Straße überqueren: Wenn sie keinen Plan haben, kommen sie womöglich nicht auf der anderen Seite an. Aber sie müssen auch immer darauf vorbereitet sein, plötzlich zur Seite springen zu müssen.
Mit einem der Mitglieder des Living Theatre haben Sie auch das Stück »Coming Together« über einen der Anführer der Gefängnisrebellion in Attica 1971 aufgenommen. Sind Sie eigentlich überwacht worden, als Sie noch in den USA lebten?
Nein, davon weiß ich zumindest nichts. Ich hoffe, dass ich nicht observiert wurde – denn das wäre eine ungeheuerliche Verschwendung von Steuergeldern gewesen.
Hanns Eisler ist für Sie ein besonders wichtiger Komponist. Warum?
Er hat seinen Platz in der Geschichte. Aber Geschichte ereignet sich erst als Tragödie, dann als Farce. Etwas, das mich bis heute an seiner Musik stört, ist ihre militärische Qualität. Ich habe Sergio Ortega einmal gefragt, warum er ständig Märsche schreibe. Er antwortete, dass dies die beste Art sei, einer großen Anzahl von Menschen zu helfen, eine Straße entlangzuziehen. Ich vermute, er hat recht. Auf der anderen Seite geht es aber im Leben nicht nur darum, eine Straße hinunterzumarschieren. Im Moment wird uns zum Beispiel gesagt, dass wir in unseren Häusern bleiben sollen.
In den 60er-Jahren fuhren Sie täglich von West- nach Ostberlin in das Studio für akustisch-musikalische Grenzprobleme, um dort an Ihrem Auftragswerk »Zoologischer Garten« zu arbeiten. Wie haben Sie das Kulturleben in der DDR wahrgenommen? Die elektro-akustische Musik stand ja in der Kritik, im Studio wurde aber auf diesem Feld durchaus Pionierarbeit geleistet.
Meiner Wahrnehmung nach wurde die elektronische Musik nicht kritisiert, und das Subharchord, eine Vorform des Synthesizers, war das vielleicht avancierteste Instrument seiner Zeit! Das Studio wurde zwar nicht vornehmlich für künstlerische Projekte benutzt, sondern etwa auch, um tschechische Animationsfilme zu vertonen. Aber viele der frühen »experimentellen« Studios entstanden für kommerzielle Zwecke. Ich persönlich fand es sehr interessant, die Arbeits- und Alltagsrealität in der DDR erleben zu können – die im Übrigen ganz anders war, als es das vom Westen verbreitete Zerrbild einem vorgaukelte.
Was waren denn die größten Propagandalügen des Westens über die DDR, und wie war’s dort wirklich?
In der Politik ist nichts falsch an Lügen. Im Gegenteil – wie Quintus seinem Bruder Cicero sagte, als dieser versuchte, zum Konsul zu werden: Wenn du gewählt werden möchtest, ist es das Wichtigste, Versprechen zu machen, die du gar nicht einhalten willst. Als ich 1978 zum Festival des politischen Liedes in Berlin war, besuchte ich zusammen mit einer Gruppe Paul Dessau. Er war damals 84 Jahre alt. Er erzählte, dass er nicht viel aus seinem Haus herauskomme, und fragte, was in der Stadt los sei. Jemand erwähnte, dass der Komponist Wolfgang Hohensee eine Kantate geschrieben habe, die auf Texten aus dem Neuen Deutschland basiere. Dessau fragte, wie alt dieser Komponist sei – er muss das eigentlich gewusst haben; entweder hatte er es wirklich vergessen, oder er tat nur so. »51«, so die Antwort. Dessau darauf: »Ich wusste nicht, dass Senilität so früh einsetzt.«
Was wollte Dessau damit sagen?
Vermutlich, dass zu der Idee, eine Kantate aus Texten einer Parteizeitung zu machen, eine gehörige Portion Senilität gehört. Aber er war ein leidenschaftlicher Kommunist …
… offenbar ein sehr kritischer?
Als wir über Stalin sprachen, sagte er, dass zu viel Macht in den Händen einer Person liege, und lobte das US-amerikanische Wahlsystem. Er war wirklich ein witziger und geistreicher Mann. Ich war einmal bei ihm zum Abendessen eingeladen. Nach dem Dinner bat er mich, etwas zu spielen. Aber ich war viel zu betrunken, also hörte ich nach wenigen Minuten auf. Er fragte mich, ob etwas mit meinem Essen nicht in Ordnung gewesen sei. Dann erzählte er die Geschichte von Chopin, der sich einmal in einer ähnlichen Situation befunden haben muss. Als dieser gefragt wurde, warum er denn nur so wenig gespielt habe, soll er geantwortet haben: Ich habe so viel gespielt, wie ich gegessen habe.
Dessau stellte sich auch schützend vor das Studio für akustisch-musikalische Grenzprobleme, trotzdem wurde es aus »musikpolitischen Gründen« 1970 geschlossen. Diese Widersprüche in der Kulturpolitik der DDR gab es ja auch deswegen, weil man das L’art pour l’art der bürgerlichen Avantgarde ablehnte.
Sicherlich, die DDR war voller Widersprüche. Ich bin dort vielen intelligenten Kommunisten begegnet – etwa dem bekannten Musikwissenschaftler Günter Mayer –, aber die waren nicht an der Macht. Ich habe auch einige mächtige Personen getroffen, wie Egon Krenz. Das vielleicht gravierendste Problem in den sozialistischen Ländern war die Dummheit – was sich womöglich auch als das Hauptproblem der »freien Welt« herausstellen könnte …
Sie haben 2016 ein Stück zum Tod von Fidel Castro und der Avantgardekomponistin Pauline Oliveros geschrieben. Der Titel »Saints and Sinners« wurde gelegentlich so interpretiert, dass Fidel für den Sünder steht. Wollen Sie das kommentieren?
Eigentlich nicht. Wie können diese Leute das Stück überhaupt kennen, wenn es von niemandem außer mir selbst bisher gespielt und es auch noch nicht aufgenommen wurde? Ich kann Ihnen dazu Folgendes sagen: Die Melodie am Anfang stammt von dem Stück »Iroes« (Helden), das in den 90ern durch die Sängerin Maria Dimitriadi populär wurde. Was Fidel und sie gemeinsam hatten, war schlichtweg, dass sie kurz hintereinander verstorben sind. Der Titel bezieht sich auf die augustinische Theorie der Kirche als Corpus permixtum, also als »gemischter Körper« aus Heiligen und Sündern; beide sind notwendig.
Sind die »Helden« in der Partisanenhymne notwendigerweise gleichzeitig Heilige und Sünder? Brecht schrieb in »An die Nachgeborenen«: »Ach, wir/ Die wir den Boden bereiten wollten für Freundlichkeit/ Konnten selber nicht freundlich sein.«
Ja, das gilt auch für das, worüber Brecht sprach. Ich bin nicht religiös, aber diese Fragen faszinieren mich. Ich denke, ein Komponist muss sich mit ihnen genauso beschäftigen wie mit dem Kontrapunkt. Zweifellos müssen wir auch den Teufel ernst nehmen. Was Wissenschaftler nicht akzeptieren können, ist für uns nicht nur möglich, sondern sogar zwingend.
Sie sind einer der wenigen Komponisten, die eine gemeinsame Sprache von Tonkunst und populärer Musik entwickelt haben, in der beide Sphären gleichwertig behandelt werden. Kann man Ihre Arbeit als dialektisches Komponieren begreifen?
Sie scheinen sich viel mit Dialektik zu beschäftigen. Ich würde mich gern von diesen philosophischen Kategorien fernhalten, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Ich mag Hegel, aber Hölderlin mag ich lieber. Begriffe haben einen hohen Stellenwert, auch in der Musik, aber dieser scheint mir doch sehr unmusikalisch … »Nah ist/ Aber schwer zu fassen/ Der Gott.«
»Wo aber Gefahr ist, wächst/ Das Rettende auch«, heißt es weiter in Hölderlins »Patmos«. Also reden wir über die Einheit von Gegensätzen. Ihre Musik hat oft etwas Tröstendes.
Es freut mich, wenn Sie meine Musik als »tröstend« wahrnehmen, aber das ist Ihre Empfindung, nicht meine. Ich denke, überhaupt Musik zu haben, ist besser, als keine zu haben. Es ist das Gleiche wie mit einem Gebet: Es ist nicht rational, gleichzeitig aber auch keine Magie – es hat eher etwas von einem Glücksspiel. Wir können nicht wissen, welche Kräfte uns kontrollieren; wir können nur hoffen, ihnen zu entkommen.
Arbeiten Sie derzeit an einem neuen Projekt?
Ich habe gerade ein Stück für die in San Francisco lebende Pianistin Sarah Cahill geschrieben, »Humanitas«. Es endet mit einem Zitat von Oscar Wilde: »And all men kill the thing they love/ By all let this be heard:/ Some do it with a bitter look/ Some with a flattering word/ The coward does it with a kiss/ The brave man with a sword!« (Doch jeder tötet, was er liebt/ Ich sag es, dass es jeder hört!/ Der tut es mit dem bösen Blick/ Der mit Schmeicheln, das betört/ Der Feigling tötet mit einem Kuss/ Der Kühne greift zum Schwert!)
Wie gehen Sie mit der Coronaepidemie um? Und was haben die Kulturschaffenden angesichts dieser Krise zu tun?
Corona? Ich denke, dass derzeit mein Haus mit meinem Klavier für mich der beste Aufenthaltsort ist. Und meine Botschaft an die Kulturschaffenden: Verändert die Welt, indem ihr bessere Kunst macht!
Frederic Rzewski
Songs of Insurrection
Takuroku
Das komplette Interview erschien in der Melodie & Rhythmus 3/2020. Die Ausgabe können Sie auch im M&R-Shop bestellen.
Anzeigen


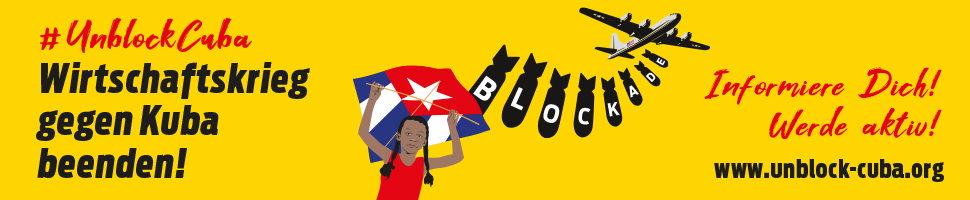

 Fotos von Katja Koschmieder und Jens Schulze
Fotos von Katja Koschmieder und Jens Schulze








