
Foto: AKG-Images
Historische Leiderfahrung
»Sixteen Tons« ist ein von Merle Travis im Jahre 1947 veröffentlichter Country-Folksong, der sich in beeindruckender Weise sozialkritisch mit den Lebens- und Arbeitsverhältnissen US-amerikanischer Minenarbeiter befasst. Populär und, wie es heißt, zum »Millionenseller« wurde er durch die wohl bekannteste unter den hunderten, über Jahrzehnte entstandenen Coverversionen, nämlich Tennessee Ernie Fords Interpretation von 1955.
Über die Urheberschaft des Songtextes und der Komposition gibt es Kontroversen. Aber davon ausgehend, dass Merle Travis den Song geschrieben hat, sollte angemerkt werden, dass der Titel lebensgeschichtliche Authentizität beanspruchen darf: Travis wuchs in der Bergbauregion von Muhlenberg County, Kentucky auf; er entstammte einer Minenarbeiterfamilie, und es wird auch behauptet, dass gewisse Motive im Text auf Zitaten seiner Angehörigen basieren. Hört man zudem die mit einem rhythmischen Fingerschnippen eingeleitete Intonation der synkopierten, leicht gospelartig anmutenden Swingmelodie des Songs aus dem Munde von Tennessee Ernie Ford, weiß man sofort: Hier wird eine von Arbeitsfron geprägte schwarze Leiderfahrung mit den Stilmitteln schwarzer Musik besungen.
Aber weder Merle Travis noch Tennessee Ernie Ford waren schwarz. Das wirft eine interessante Frage auf − wenn man bedenkt, dass der Song zu einer Zeit geschrieben und veröffentlicht wurde, als die Bürgerrechte der Schwarzen in den USA erst noch erkämpft werden mussten (es bestehen gravierende Zweifel, dass dieser Kampf je wirklich das von ihm Erhoffte gezeitigt hat). Schwarze Musik durfte im 20. Jahrhundert einen fulminanten Siegeszug durch die gesamte Pop- und Jazzkultur in der Welt und vor allem in den USA verzeichnen. Das ist bekannt. Dass zudem Performer wie Janis Joplin und Joe Cocker in einer Weise »schwarz« zu singen verstanden, die das unverwechselbare afroamerikanische Musikidiom ins Extreme trieb, ist auch schon allseits bewundert worden.
Aber nicht von ungefähr warf seinerzeit Umberto Eco die Frage auf, was es mit Gershwins »Rhapsody in Blue« auf sich habe: Ein jüdischer weißer Komponist transformiert schwarzes musikalisches Folkloregut ins Sinfonische. Eco ließ noch Gershwins Werk selbst als gelungene Synthese gelten, aber die Aufführung in einem bürgerlichen Konzertsaal nahm sich für ihn wie Kitsch aus. Auf ähnliche Weise ließen sich gewisse Teile von Leonard Bernsteins Komponisten- und Benny Goodmans Aufführungstätigkeit hinterfragen. Zwar könnte man dagegenhalten, dass Kunst auf derlei ethnisch-rassische Vorbehalte keine Rücksicht zu nehmen brauche; einzig die Werkqualität und die Materialästhetik hätten zu bestimmen. Aber nicht von ungefähr sprach jüngst Spike Lee Quentin Tarantino das Recht ab, das Wort »Nigger« so exzessiv in seinem Film »Django Unchained« zu verwenden. Von einer unzulässigen Vereinnahmung schwarzer historischer Leiderfahrung war da die Rede.
Im Sinne heutiger politischer Korrektheit mag dieser Einwand bzw. Vorwurf akzeptabel erscheinen. Und doch muss er konterkariert werden. Denn wenn man daran festhält, dass »Leiden beredt werden zu lassen Bedingung aller Wahrheit« sei, dann kann auf derlei partikulare Idiosynkrasien keine Rücksicht genommen werden. Eine Sache ist es, zu behaupten, die Aufführung von »Rhapsody in Blue« im weißen bürgerlichen Konzertsaal verkomme – kontextbedingt – zum Kitsch, eine andere, den universellen Anspruch menschlicher Emanzipation durch eine ethnisch-rassische Bestimmung des Sprachsubjekts einschränken zu wollen. Das »Schwarze« an »Sixteen Tons« bedient sich des Paradigmas historischer Leiderfahrung der Schwarzen. Nicht zuletzt ist der Song gerade darin bedeutend geblieben.
Moshe Zuckermann ist Kunsttheoretiker und lehrt an der Universität Tel Aviv (u. a. Kritische Theorie). Er hat diverse Bücher und Aufsätze über Kunstautonomie und zur Kulturindustriethese von Theodor W. Adorno veröffentlicht. Darunter »Kunst und Publikum. Das Kunstwerk im Zeitalter seiner gesellschaftlichen Hintergehbarkeit«. In den 1970er-Jahren war er als Komponist und Arrangeur tätig. Foto: Arne List
Den Artikel lesen Sie in der Melodie und Rhythmus 3/2016, erhältlich ab dem 29. April 2016 am Kiosk, im Bahnhofsbuchhandel oder im Abonnement. Die Ausgabe können Sie auch im M&R-Shop bestellen.
Ähnliche Artikel:



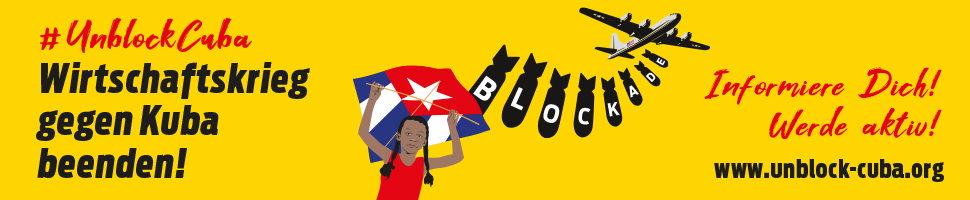

 Fotos von Katja Koschmieder und Jens Schulze
Fotos von Katja Koschmieder und Jens Schulze








