
Harlem Riots 1964: »Come Out« fasst die aufgeheizte Stimmung jener Jahre in Klang
Foto: Library Of Congress / wikimedia.org / public domain
Vor 50 Jahren reflektierte Steve Reichs »Come Out« rassistische Polizeiwillkür
Fabian Schwinger
»I can’t breathe«: Seit der Afroamerikaner Eric Garner 2014 im Würgegriff eines New Yorker Polizisten verstarb, gehören die letzten Worte des 43-jährigen Gartenbauers zur beharrlich wiederholten Parole auf Protestmärschen der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Initiativen wie Black Lives Matter schenken dem Opfer einer systematisch auf Diskriminierung angelegten Justiz so auch weiterhin eine deutlich vernehmbare Stimme. Vom Prinzip her ähnlich, nur auf dem Gebiet der Musik, hat dies der Komponist Steve Reich mit seinem Tonband- Stück »Come Out« getan, das er vor nunmehr 50 Jahren, am 17. April 1966, erstmals der Öffentlichkeit vorstellte: Ausgehend von einem O-Ton des 19-jährigen Daniel Hamm, ebenfalls Opfer grassierender Polizeigewalt, entwickelte Reich ein verstörendes Sound-Panoptikum, das die aufgeheizte und in Massenprotesten gipfelnde Stimmung in den USA der 1960er-Jahre denkbar treffend einzufangen wusste. Seit seiner Uraufführung ist das Werk zu einer Inkunabel der sogenannten Minimal Music avanciert; mit ihm schaffte es der damals knapp 30-jährige Reich, erstmals Aufmerksamkeit in der New Yorker Kunstszene zu erregen, bevor er mit größer besetzten Stücken wie »Drumming« oder »Music for 18 Musicians« in den 1970ern internationale Bekanntheit erlangte.
Die Harlem Six
In dem 13-minütigen Werk bedient sich Reich nur eines einzigen Satzes von Daniel Hamm, dessen Aufnahme er zu Beginn, einem Zauberspruch gleich, dreimal vollständig wiederholt: »I had to, like, open the bruise up and let some of the bruise blood come out to show them« (Ich musste die Prellung öffnen und etwas Blut herausfließen lassen, um es ihnen zu zeigen). Die ohne Zusammenhang präsentierte Äußerung wirkt heute rätselhaft, doch das Publikum der Uraufführung in der New Yorker Town Hall wusste genau, welche Dramatik sie barg: Gemeinsam mit fünf anderen schwarzen Teenagern war Hamm im Frühjahr 1965 des Mordes an Margit Sugar, der jüdischen Besitzerin eines Secondhand-Kleidermarkts, angeklagt worden. Eingeschüchtert und zu Geständnissen gezwungen, machten die Beamten mit den »Harlem Six« kurzen Prozess und verurteilten sie alle pauschal zu lebenslanger Haftstrafe. Hamm aber war unschuldig und nur deshalb ins Visier der Polizei geraten, weil er schon vorher durch tatkräftigen Widerstand gegen sie aufgefallen war: Als in Harlem postierte, schwer bewaffnete Sonderkommandos der Polizei mit Schlagstöcken auf eine Gruppe Schulkinder losgingen, weil diese sich einen Spaß daraus machten, mit von einem Obststand heruntergefallenen Grapefruits Baseball zu spielen, hatte Hamm die anwesenden Passanten zum Einschreiten aufgerufen. Dafür wurde er gemeinsam mit anderen auf die Polizeistation des 28. Reviers gebracht und dort schwer misshandelt. Als alle sichtbar Verletzten ins Krankenhaus überwiesen werden sollten, begriff Hamm geistesgegenwärtig seine Möglichkeit zur Flucht und kratzte sich seine Wunden blutig.
Endlosschleifen
Hamms Schilderung dieses »Little Fruit Stand Riot« wurde als Zeugenaussage auf Tonband festgehalten. In Reichs Hände gelangte sie – mit weiteren Interviews von Hamms Mitgefangenen, deren Müttern und Polizeibeamten – Anfang 1966 durch den Aktivisten Truman Nelson. Dieser bat Reich, aus dem Material eine Toncollage für eine Benefizveranstaltung in der Town Hall zu basteln, auf der Geld für eine Revision des Gerichtsverfahrens gesammelt werden sollte. Reich tat dies – und noch mehr: Er spürte unter dem zehnstündigen Berg von O-Tönen jenen einen Satz Hamms auf, dessen musikalische Qualität ihn so begeisterte, dass er ihn nach eigenen künstlerischen Maximen bearbeitete. Aus dem Satzende »co me out to show them« erstellte Reich zwei Loops von exakt gleicher Länge, die er mit derselben Geschwindigkeit auf zwei Bandmaschinen in Endlosschleife ablaufen ließ. Dann sorgte er für sogenannte Phasenverschiebung, deren ästhetische Tragweite Reich erst kurz zuvor im Tonstudio entdeckt hatte: Von den zwei synchron ablaufenden Tonbändern bremste der Komponist eines ganz allmählich mit aufgelegtem Daumen ab (wohlgemerkt: Wir befinden uns noch im Zeitalter der Analogtechnik). Diese graduelle Verlangsamung des einen Loops sorgt auf psychoakustischer Ebene dafür, dass Daniel Hamms Worte sich zunächst im Klang verfärben (so wie es der unter Gitarristen beliebte Phaser-Effekt tut), dann einen immer stärkeren Hall erhalten, der sich zum handfesten Echo herausbildet, bis das verzögerte Band schließlich als selbstständige, kontrapunktische Stimme im Raum steht.
Symbolische Ermächtigung
Bis heute ist die allmähliche Formwerdung der zweiten Stimme aus der ursprünglichen Synchronität ein befremdliches und zugleich unglaublich sinnliches Erlebnis. Man hat die beiden Stimmen gerade erst als eigenständig erkannt, da werden sie vom Komponisten schon wieder verdoppelt, und mittels Phasenverschiebung erneut aus der Synchronität in ein kontrapunktisches Verhältnis überführt – aus zwei werden vier. Aufgrund der zunehmenden Klangdichte gestaltet es sich zugleich immer schwieriger, die einzelnen Stimmen überhaupt noch als solche wahrzunehmen. Die Sprachverständlichkeit verringert sich dramatisch, bald dringen nur noch einzelne Wortfetzen an das Ohr. Als die vier Stimmen im letzten Drittel des Stücks erneut verdoppelt werden, lösen sich die verbliebenen Reste der Sprachmelodie in einem sirenenartigen Drone auf, aus dem nur noch die Silbe »ma« und das markante Phonem »sch« rhythmisch herausstechen. Hamms ursprüngliche Aussage hat sich zu einer abstrakten Klanglandschaft ausgewachsen, in der das Stück schließlich endet.
Aus der vielfachen Überlagerung und Bearbeitung des originalen O-Tons ergeben sich changierende Rhythmen und melodische Muster, »unpersönliche, unbeabsichtigte, psychoakustische Nebenprodukte«, wie Reich sie nennt, die dem Stück eine fast schon metaphysische Würze verleihen: »Auch wenn mit offenen Karten gespielt wird und jedermann hört, was sich – graduell – in einem musikalischen Prozess abspielt, bleiben noch genügend Geheimnisse für alle übrig.« Aus diesen Leerstellen speist sich die anhaltende Faszination für »Come Out« wie auch sein gesellschaftskritisches Potenzial: Im Anwachsen seiner Stimme zu ei- nem kollektiven Gewirr wird dem Opfer Hamm zwar nur symbolische, aber doch tröstende Ermächtigung zuteil; zugleich kann der graduelle Prozess, mit dem die Verständlichkeit von Hamms Sprache in klangliche Abstraktheit umkippt, als kritisches Bild des Verstummens, als Unterwerfung des Individuums unter die Regeln eines systemischen Apparats gelesen werden. Die wirbelnden Sounds am Ende des Stücks ähneln Alarmsirenen, die die beunruhigende Atmosphäre in den US-amerikanischen Städten der 1960er spiegeln, und das pulsierende »sch« imitiert einen heftig nach Luft schnappenden Körper. Eine Verfolgung, eine Jagd – gar die Vertonung einer traumatischen Gewaltsituation? Der dokumentarische Charakter, von dem das Stück ausgeht, wandelt sich in Reichs Lesart in zahlreiche Metaerzählungen um.
Noch während »Come Out« auf der Benefizveranstaltung in der Town Hall erklang, ging die Spendendose im Publikum herum. Mit den hier und anderswo gesammelten Geldern konnten die Angeklagten tatsächlich in Berufung gehen. Unter einer neuen Verteidigung wurden Daniel Hamm und vier seiner Mitangeklagten freigesprochen – Verhandlungen, die sich noch bis ins Jahr 1973 ziehen sollten. Da hatte Hamm schon etliche Jahre hinter Gittern verbracht und die Bürgerrechtsbewegung eine ihrer zentralen Figuren, Martin Luther King, längst verloren. Willkürliche Gewalt staatlicher Ordnungskräfte gegen die schwarze Bevölkerung aber ist, wie uns die Geschehnisse in Ferguson, Baltimore und anderen Städten vor Augen führen, in den USA weiter an der Tagesordnung – und mit der Ausweitung des »prison-industrial complex« drohen den Afroamerikanern noch mehr Repressionen. Für viele heißt es, Daniel Hamms Rede vom »Come Out« wörtlich zu nehmen: nämlich auf die Straße zu gehen und Präsenz zu zeigen gegen jede Form staatlicher Diskriminierung.
Den Artikel lesen Sie in der Melodie und Rhythmus 3/2016, erhältlich ab dem 29. April 2016 am Kiosk, im Bahnhofsbuchhandel oder im Abonnement. Die Ausgabe können Sie auch im M&R-Shop bestellen.
Anzeigen


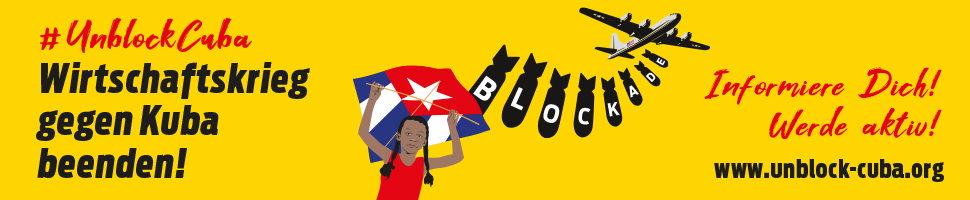

 Fotos von Katja Koschmieder und Jens Schulze
Fotos von Katja Koschmieder und Jens Schulze








